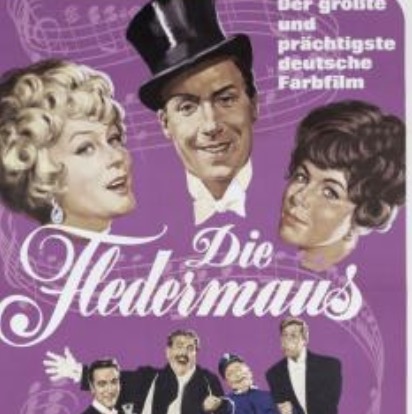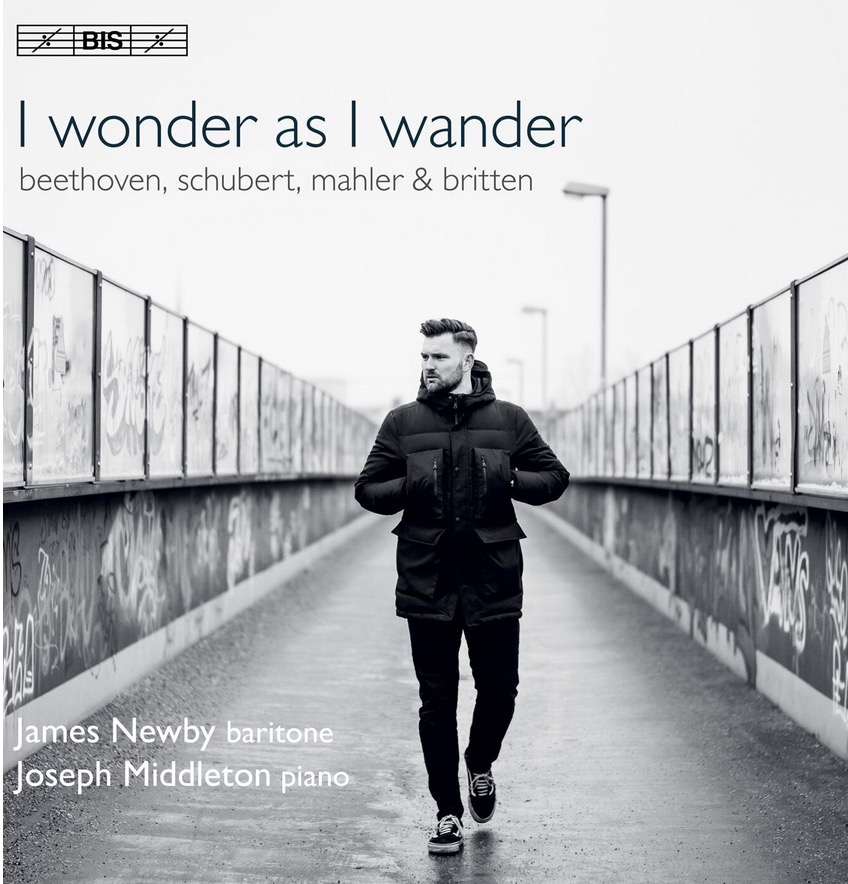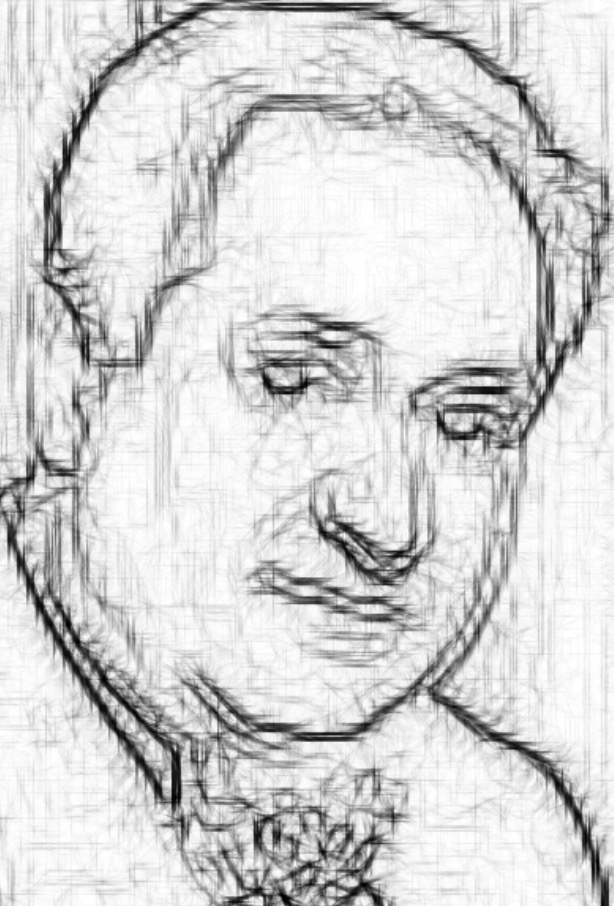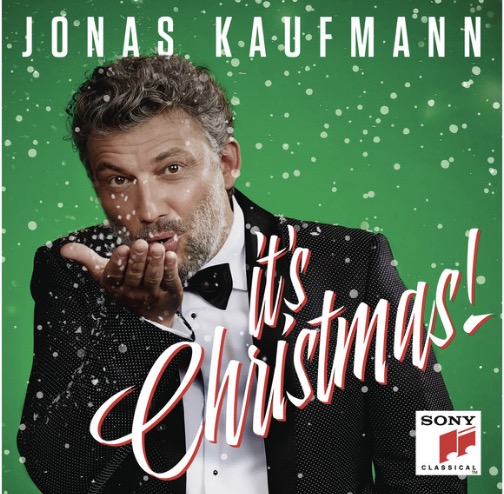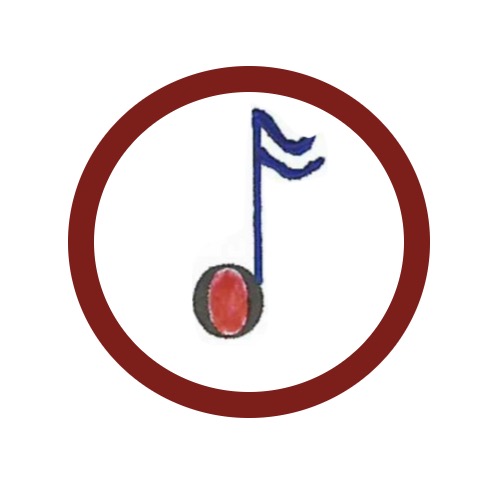NEUJAHRSKONZERT
Jahresauftakt
Die Wiener Philharmoniker musizieren heute vormittag unter Daniel Barenboim für ihr TV-Millionenpublikum. Sie haben sich wieder ein Programm ausgesucht, das einige der bekanntesten Melodien der Wiener Strauß-Dynastie mit kaum je gespielten Werken mischt. Auch Kenner können also jedenfalls wieder allerhand entdecken.
Das Programm
- Josef Strauß Phönix-Marsch, op. 105
- Johann Strauß II. Phönix-Schwingen. Walzer, op. 125
- Josef Strauß Die Sirene. Polka mazur, op. 248
- Josef Hellmesberger (Sohn) Kleiner Anzeiger. Galopp, op. 4
- Johann Strauß II. Morgenblätter. Walzer, op. 279
- Eduard Strauß Kleine Chronik. Polka schnell, op. 128
- Johann Strauß II. Ouvertüre zur Operette „Die Fledermaus“
- Johann Strauß II. Champagner-Polka. Musikalischer Scherz, op. 211
- Carl Michael Ziehrer Nachtschwärmer. Walzer, op. 466
- Johann Strauß II. Persischer Marsch, op. 289
- Johann Strauß II. Tausend und eine Nacht. Walzer, op. 346
- Eduard Strauß Gruß an Prag. Polka française, op. 144
- Josef Hellmesberger (Sohn) Heinzelmännchen
- Josef Strauß Nymphen-Polka, op. 50
- Josef Strauß Sphärenklänge. Walzer, op. 235
DETAILS zum Programm im SINKOTHEK-ARCHIV
Massenet aus New York
Die Metropolitan Opera streamt heute Abend Laurent Pellys Inszenierung von Jules Massenets zauberhafter Aschenputtel-Oper Cendrillon in die internationalen Kinosäle. Zu erleben sind Isabel Leonard, Jessica Pratt, Stephanie Blythe, Emily D’Angelo und Laurent Naouri unter der Leitung von Emmanuel Villaume.