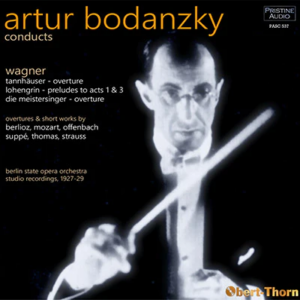1887 – 1915
Am 29. September 1915 fiel der deutsche Soldat Rudi Stephan bei Tarnopol in Galizien (heute Ukraine) auf dem Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs. Er war 28 Jahre alt – und galt trotz seiner Jugend in Friedenszeiten als einer der Hoffnungsträger der deutschen Musik, Seine Oper → Die ersten Menschen, seine symphonischen Werke, die (zweite) Musik für Orchester, die Musik für Geige und Orchester hatten ihn in die erste Riege der jungen Komponisten katapultiert.
In einem Nachruf, den Kasimir Edelschmid 1915 in der »Frankfurter Zeitung« publizierte hieß es:
Sein Gerechtigkeitssinn war von solch glasharter Schärfe und Durchsichtigkeit, dass es das Auskommen mit ihm erschwerte. Er war weniger impulsiv als abwägend. Kleinigkeiten, über die andere, auch vornehme Menschen, lächelnd weggingen, beschäftigten sein moralisches Bewusstsein lange … In all seinen Handlungen, selbst in seinem Lachen, das er gern und tief lachte, war ein besonderer Ernst. Sein Urteil war gerecht und radikal wie bei Menschen, die, von innerer Berufung schlicht überzeugt, für eine Sache leben. Ich glaube nicht, dass seinem Wesen die große Güte fehlte, die die Grundlage einer großen Leistung ist. Er war ohne Aufheben von sich überzeugt mit der inneren Bescheidenheit der mittelalterlichen Meister.
Prägungen
Studiert hatte Stephan, der sich schon in seiner Gymnasialzeit vor allem für die musischen Dinge interessiert hatte und daher ein schlechter Schüler war, bei Bernhard Sekles (1872-1934). Dieser wiederum war einer der profiliertesten Kompositionsprofessoren seiner Generation. Zu seinen Schülern zählten – nach Staphen – Paul Hindemith, Hans Rosbaud (1895-1962) und Theodor W. Adorno (1903-69).
Nach seiner Übersiedlung nach München setzte Stephan seine Studien bei Rudolf Luis (1861 – 1907) fort, der ihn mit der Ästhetik des Kreises um Ludwig Thuille (1861-1907) vertraut amchte, die wiederum Richard Strauss und Hans Pfitzner nahestand. — Wobei Juliane Brand, die die essentielle Stephan-Biographie geschrieben hat, darauf verweist, daß Stephan selbst in seinen autibiographischen Skizzen festgehalten hat, bei Sekles Harmonielehre und Klavier, bei Louis Kontrapunkt und Fuge studiert zu haben. Der Nachlaß Rudi Stephans wurde 1945 durch die Explosion einer Brandbombe am Tag nach dem schwersten Bombenangriff auf Worms zerstört. Angeblich hat sich darin keine einzige Kompositionsübung gefunden, die auf einen nachhaltigen Kompositions-Unterricht hätte schließen lassen.
Der Zug der Zeit
Mit dem handwerklichen Rüstzeug des Tonsatz-Studenten und auf die Kraft der Inspiration vertrauend, entwarf der nach dem Zeugnis von Freunden langsam und bedachtsam arbeitende Rudi Stephan Skizzen über Skizzen hervor, an denen er ständig feilte und verbesserte. Sein Oeuvrekatalog begann mit einer lediglich im Entwurf beendeten Marcia eroica (1905). Auch die Werke des folgenden Jahres — Ballettszene, Scherzo und Idylle — blieben unfertig liegen.
Als eine Art Abschlußarbeit während des Studiums bei Rudolf Louis bildete das am 1. Juli 1908 in München vollendete »Opus I« für Orchester, ein einsätziges Werk, dem der Komponist sein Motto voranstellte:
Vorwärts sehen, vorwärts streben — keinen Raum der Schwäche geben!
Das Musterstück für die später so erfolgreiche Musik für Orchester war geboren. Die Partitur dieses »Opus 1« fand sich nach dem Zweiten Weltkrieg unter der irrtümlichen Verschlagworung Rudi Stephan: »Konzert für Orchester« in einem Archiv in München.
Offenbar hatte das Münchner Konzertvereins-Orchester das Werk zurückgewiesen und Stephan hatte das Manuskript nicht zurückgefordert —. ein Glücksfall für die Musikwissenschaft, da es andernfalls vermutlich bei dem Bombenangriff auf Worms vernichtet worden wäre.
Als » Opus II« schrieb Stephan 1909 eine heute nicht mehr auffindbare Version seines Liebeszaubers für Tenor und Orchester, als »Opus III« folgte 1910 die (erste) Musik für Orchester, die Stephan später zurückzog und 1912 durch ein gleichnamiges, aber völlig anderes, knapperes Werk ersetzte.
Ein erstes Privatkonzert
Ob das »Opus IV« eine Musik für Geige und Orchester von 1910/11, eine Vorform zum heute bekannten Werk gleichen Namens darstellte, oder — wie die erste Musik für Orchester — ein anderes Werk gewesen ist, kann nicht ermittelt werden. Die Partitur ist verschollen.
Diese (erste) Musik für Geige und Orchester hielt der skrupulöse Stephan jedenfalls für aufführenswert. Da niemand sich für eine Musik interessierte, stellte sein Vater Geld zur Verfügung, um ein privates Konzert mit dem Münchner Konzertvereins-Orchester zu veranstalten. Bei dieser Gelegenheit stellten der Geiger Wolfgang Bülau die Geigenmusik, der Tenor Adolf Wallnöfer den Liebeszauber vor. Der 16. Januar 1911 ist also in die Annalen als erstes wichtiges Uraufführungsdatum von Werken Rudi Stephans eingegangen. Doch spielte das Konzertvereins-Orchester die ungewohnte Musik nach übereinstimmender Zeugenaussage eher lustlos herunter, nachdem Chefdirigent Ferdinand Loewe die Partituren als »chinesisch« und »völlig unverständlich« bezeichnet hatte.
Die mehrheitlich ablehnende Haltung löste in dem unermüdlich an sich arbeitenden Stephan einen Reflexionsschub aus. Er revidierte vorhandene Partituren und schuf Neues, ohne sich in seiner grüblerischen, akribischen Arbeit irritieren zu lassen.
Neue Sachlichkeit
In dieser Phase brachte Stephan zwei wesentliche Werke für den Konzertgebrauch zu Notenpapier: Die Musik für Orchester und die Musik für sieben Saiteninstrumente. Es sind früheste Dokumente einer Geisteshaltung, die sich von der spätromantischen Programmusik ab- und einer sachlich-distanzierten Musizierhaltung zuwandte, die von Meistern wie Paul Hindemith und – in anderem Umfeld – Igor Strawinsky später kultiviert wurde und zur »Neuen Sachlichkeit« beziehungsweise zum » Neoklassizismus« führen sollte.
br> Heinz Tiessen, ein Komponisten-Freund Rudi Stephans, stellte nach den Uraufführungen der beiden Werke (1912 und 1913) fest:
Wie eine Fanfare des resolutesten Abrückens von der Programm-Musik wirkten auf den Musikfesten der Jahre 1912 und 1913 die Titel, die Rudi Stephan seinen Werken gab: »Musik für sieben Saiteninstrumente, Musik für Orchester.« Wichtiger aber als der Titel war — im zweiten Werk — die neue, frische, knappe Energie der Musik selbst, die (trotz Delius und Reger) das übrige Jenenser Festprogramm weit hinter sich ließ.
Tod im Schützengraben
Am 2. März 1915 wurde Rudi Stephan zum Kriegsdienst einberufen. Die Reise an die Front führte über Berlin – wo er sich nicht überwinden konnte, den Freund Heinz Tiessen aufzusuchen. In einem Brief vom 6. August 1915 begründete er diese Verweigerung:
Wäre ich nun so, wie ich es ja wollte, erst recht zu Ihnen gegangen und wäre ich durch Sie noch mehr meinen Musik- Sehnsüchten verfallen — es wäre an sich eine schöne Stunde geworden; aber auch umso grässlicher wäre das Erwachen gewesen auf der Rückfahrt im Nachtzug im Abteil — ‚für Militärpersonen‘!
Der Tod durch eine feindliche Kugel ereilte den Komponisten-Soldaten schon wenige Tage nach der Ankunft an der Front, wo einander deutsche und Russische Truppen gegenüberlagen. Der Kompanieführer berichtete an Stephans Eltern:
In der Nacht vom 28. auf 29. griffen uns die Russen an und waren in der Dunkelheit bis an den Draht herangekommen. Der Angriff wurde abgeschlagen, sodaß wir, als wir am Abend des 29. das Kampffeld absuchten, im Raum von 100 Meter 150 Tote und 40 Schwerverwundete fanden, außerdem noch 35 unverwundete Russen, die sich vor unserem Hindernis eingegraben hatten. Einer von diesen letzteren hat nun auf Ihren Sohn — es war zwischen 9 und 10 Uhr morgens — einen Schuß abgegeben, wie dieser durchs Glas das Vorgelände beobachtete vom Schützengraben aus und ihm einen Kopfschuss beigebracht, sodaß er sofort tot war. Ob nun etwas Unvorsichtigkeit dabei war, das kann ich nicht feststellen. Wir haben ihn hinter unserer Front abends unter Schutz der Dunkelheit mit allen Ehren begraben.
Juliane Brand teilt in ihrer Stephan-Biographie noch einen Bericht Karl Holls mit, der private Nachforschungen angestellt hatte:
Offenbar hatten während der Nacht auf den 29. September die verwundeten Russen im Schmerzdelirium unablässig geschrieen, nur wenige Meter von den deutschen Stellungen entfernt. Aus Verzweiflung und vor Erschöpfung geriet Stephan so außer sich, dass er am Morgen plötzlich, ehe seine Kameraden es noch verhindern konnten, mit den Worten, »ich halt’s nicht mehr aus!« im Schützengraben aufsprang und sich weit über die Brustwehr erhob. Er war ein allzu leichtes Ziel.
Der Dirigent Kirill Petrenko hat sich als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker auch für die Musik Rudi Stephans stark gemacht und seine ersten CD- und DVD-Bilanz auch Werken dieses Komponisten gewidmet.