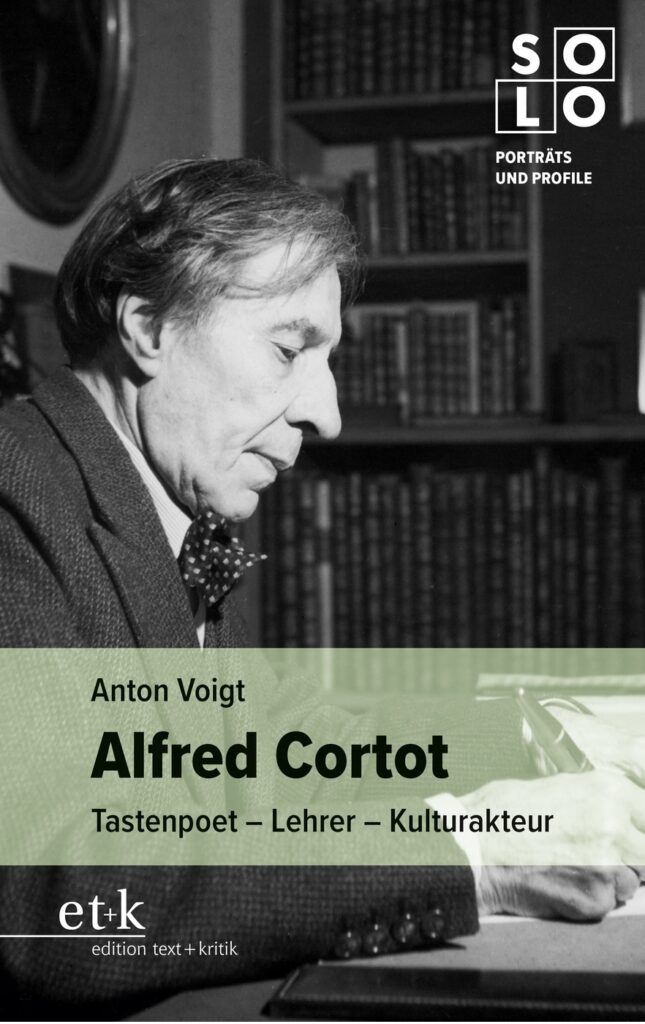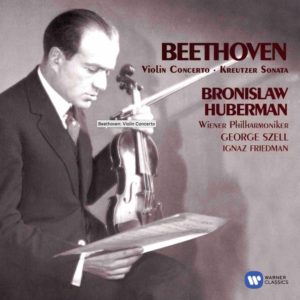Geburt der Musik aus dem Geist der Religion
Beethoven-Jahr. Wer als ein Religionswissenschaftler sollte sich an die Missa solemnis wagen? Jan Assmann schrieb eines der besten Bücher zum Jubiläum.
Ein Buch über Beethovens Missa solemnis von einem Ägyptologen und Religionswissenschaftler? Wahrscheinlich ist das die einzige Möglichkeit, diesem Gipfelwerk der abendländischen Kulturgeschichte irgendwie beizukommen. Für die Musikologie steht dieses Opus 123 ja im Schatten der umgebenden Spätwerke, der raumgreifenden Neunten Symphonie und der späten Streichquartette, um die sich längst ein ganzer Sagenkreis von mehrheitlich populärwissenschaftlicher Literatur gesammelt hat. Was diese angeblich so schwer verständliche Musik in der Aufführungsstatistik längst vor die sogenannten frühen und mittleren Quartette katapultiert hat.
Die Missa freilich hat ihren einsamen Platz auf dem musikhistorischen Denkmalsockel. Jeder Musikfreund weiß, dass es sie gibt, aber kaum einer hat viele (und vor allem denkwürdige) Aufführungen erlebt.
Das hat schon etwas mit dem enormen Respekt zu tun, mit dem man liturgischer Musik begegnet, die rätselhafterweise schon aufgrund der schieren Länge der Komposition dem liturgischen Gebrauch entrückt ist. Von einem Komponisten noch dazu, der nicht gerade als das bekannt war, was man in Wien einen Kerzelschlucker nennt – oder genannt hat; die Spezies derer, die sich darüber mokieren, dass es religiöse Menschen gibt, ist ja ausgestorben.
„Kunstwerdung“ des Gottesdienstes
Längst gilt der normalatheistische Blick auf das Kunstwerk als – sagen wir ruhig: sakrosankt. Im Fall der Missa solemnis hilft es auch, dass Theodor Adorno, der sich auf alles einen Reim machen konnte, just im Fall dieses Werks einen zweckdienlichen argumentativen Schwächeanfall erlitten hat, dessen Verstiegenheiten der Zunft der Programmheft-Autoren heutzutage mehrheitlich als einzige Informationsquelle genügen.
Und jetzt fegt Assmann die Vorstellung, man könne einem Werk wie diesem mit solch neuzeitlich-unheiliger Analytiker-Attitüde beikommen, nachhaltig vom Tisch. Der Untertitel seines Buchs bezeichnet „Beethovens Missa solemnis als Gottesdienst.“
Wer sich das Vergnügen macht, seine Beweisführung zu studieren, die – wo sonst sollte Assmann auch anfangen? – mit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten beginnt, der findet sich bald in einem Kosmos kultur- und religionshistorischer Betrachtungen gefangen. Beethoven, so erfährt man da, der sich für die Vorbereitung seiner Arbeit nicht nur in der Geschichte der geistlichen Vokalmusik bis in die Renaissance-Zeit zurückgearbeitet hatte, war auch firm in liturgischen Fragen und hat sich beim Entwurf des architektonischen Plans für den Riesenbau bald weit entfernt vom ursprünglichen Projekt, seinem Schüler Erzherzog Rudolph zur Inthronisation als Bischof von Olmütz den Festgottesdienst musikalisch auszugestalten.
Die Messe wuchs ihm über den Kopf, nahm außerliturgische Dimensionen an und wurde zu einem der bemerkenswertesten Resultate jener allmählichen „Kunstwerdung des Gottesdienstes“, die Assmann „früh und überall auf der Welt“ ortet.
Dieser „Kunstwerdung“ spürt der erste Teil des Buchs nach, der Herkunft der Zelebrationen und der Geheimnisse der christlichen Liturgie, der Abendmahls-Symbolik vor allem über das Judentum bis zurück zu heidnischen Kulten.
Kant und Schiller auf dem Schreibtisch
Virtuos, wie danach der oft diskutierten Frage über Beethovens Religionsverständnis eigenhändige Notizen und Exzerpte des Komponisten entgegengehalten werden, ein „Glaubensbekenntnis“ nach einem Schiller-Text, das hinter Glas gerahmt auf seinem Schreibtisch stand, aber auch – und vor allem – ein Kant-Zitat über den „immateriellen Gott“, der „ewig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig ist“. Diesen Text notierte sich Beethoven unter dem Titel „Hymne“ – während er die „Hymnen“ seiner Missa solemnis schrieb. Mit Plänen, „fromme Gesänge“ und ein „Herr Gott dich loben wir“ in eine Symphonie einzubinden, trug er sich schon, bevor er seine Messe zu entwerfen begann.
Assmanns musikhistorische Leistung besteht darin, dass er im zweiten Teil seines Buchs Adornos verstiegenen Thesen vom „regressiven Archaismus“ der Missa seine klare Sichtweise vom Aufbau des gesamten Werks entgegenhält: „Nicht die musikalischen Themen, die es zu entwickeln gilt, geben ihm den Weg vor, sondern der Text, den es in allen semantischen, das heißt theologischen Nuancen auszuleuchten gilt.“
Wie das geht, zeichnet Assmann in der Folge auch unter Einbindung vieler Notenbeispiele nach – und findet bei Thomas Mann noch einen Zeugen, der ausreichend über die „Trennung der Kunst vom liturgischen Ganzen“ zu philosophieren weiß.