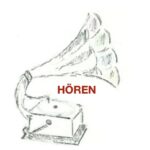Der Symphoniker
Rachmaninow als Symphoniker? Man kennt den russischen Meister als einen der großen Klaviervirtuosen seiner Zeit, der für sein Instrument Sonaten, Préludes, Etüden und Konzerte geschrieben hat, Werke, von denen er zum Teil selbst atemberaubende Aufnahmen gemacht hat. Aber als Symphoniker?
Drei Symphonien und einige Tondichtungen hat Rachmaninow komponiert. Die Erste Symphonie war ein so eklatanter Mißerfolg, daß der der Komponist in eine tiefe Lebenskrise stürzte, aus der er erst nach psychologischer Behandlung wieder auftauchte. Nach den Sitzungen mit dem Analytiker Dahl kehrte der Komponist mit seinem Zweiten Klavierkonzert triumphal ins Leben zurück.
Und doch, schon die d-Moll-Symphonie weist ihn n den Ohren aufgeschlossener Kenner auch auf dem symphonische Sektor als Meister aus, der von Tschaikowsky ausgehend, die symphonische Form in die frühe Moderne führen konnte: Die Zweite Symphonie gilt als eine der letzten großen romantischen Riesenwerke, die Dritte, im amerikanischen Exil entstanden, ist – wenn auch kaum bekannt – eine der besten Symphonien der tonalen Musik der ersten Hälfte des XX. Jahrhunderts. Die Epoche ist von Interpreten und Konzertveranstaltern freilich erst zu entdecken . . .
Die Symphonien
ERSTE SYMPHONIE
Der erste Versuch Rachmaninows galt lange Zeit als Fehlschlag, schwer realisierbar wegen der enormen technischen Ansprüche an die Musiker. Die Uraufführung im März 1897 in St. Petersburg hatte das Ihrige zu diesem Nimbus beigetragen. Sie glich einer Katastrophe. Zwar stand niemand Geringerer als Alexander Glasunow am Dirigentenpult, aber er war betrunken und setzte das Werk in den sprichwörtlichen Sand. Rachmaninow erinnert sich:
Es war, als würde er nichts verstehen.
Rachmaninow breitete den Mantel des Vergessens über sein Werk und unternahm keinen versuch einer Rehabilitierung. Fast ein halbes Jahrhundert lang glaubte man, er habe die Partitur vernichtet. Doch tatsächlich hatte er sie 1917 bei seiner Flucht aus dem revolutionären Rußland in seinem Landhaus zurückgelassen. In den Wirren der Zeit ging das Konvolut verloren. Das Autograph ist nicht wieder aufgetaucht, aber in der Bibliothek des Petersburger Konservatoriums fanden sich die Orchesterstimmen, aus denen die Partitur rekonstruiert werden konnte. So erklang die Symphonie erstmals 1945 wieder, zwei Jahre nach des Komponisten Tod.
Damals konnte die Musikwelt einen Schatz entdecken: Rachmaninows Werk war alles andere als ein Mißgriff. Vielleicht war die Musik für seine Zeit zu experimentierfreudig, sie basiert, wie viele spätere Werke des Komponisten, auf Elementen der orthodoxen Liturgie. Elemente der musikalischen Themen finden sich im »Oktoechos«, der Sammlung einstimmiger orthodoxer Gesänge. Sie dienen fast allen Themen als Grundlage. Der Partitur ist auch ein geistliches Zitat als Motto vorangestellt:
Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.
(Römer 12, 19)
Interessant ist, wem Rachmaninow sein „Rachewerk“ gewidmet hat: Anna Lodyshenskaja, der Ehefrau eines Freundes, zu der der Komponist offenbar in intimer Beziehung stammt. Das Bibeltitat fand Rachmaninow bei Tolstoj, der es in seiner »Anna Karenina« verwendet.
Als Protokoll einer menschlichen Beziehung könnte die Symphonie auch zu dechiffrieren sein. Das lyrische Seitenthema des ersten Satzes ist möglicherweise Annas Portrait, das Fugato in der Durchführung und der energetische Marsch klingen wie ein selbstgewisser Kampf und dessen siegreiches Ende.
Im Scherzo hören wir die chromatisch-grüblerischen Elemente wieder, die den Kopfsatz unterminiert hatten. Im Mittelteil klingt ein zoniges Rache-Motiv auf, das auch im Zentrum des folgenden Larghetto eine Rolle, dessen Außenteile exotisches Kolorit haben – Anna war Zigeunerin . . .
Das Finale beginnt mit festliche Fanfaren, die das Rache-Motiv in eine triumphale Geste verwandeln. doch gegen Ende überwiegt eine düstere, von Schläge des Tam-Tams begleitete Atmosphäre. Ein trügerischer Triumph?
und Inspiration des Werkes.
Variationensatzes wieder . . .
ZWEITE SYMPHONIE
Mit dem Zweiten Klavierkonzert und den Préludes op. 23 (1903) kehrte Rachmaninow nach dem Fiasko der Uraufführung der Ersten Symphonie ins Leben zurück. Inzwischen war er ein gefragter Dirigent (ab 1904 auch am M oskauer Bolschoi-Theater) und als Pianist eine Größe, die von bedeutenden Sängerin wie Fedor Schaljapin auch für Recitals genützt wurde. Ende 1906 reiste Rachmaninow ins Ausland. In Dresden – wo niemand ihn kannte – versuchte der Vielbeschäftigte auch wieder zu komponieren. So entstanden die ersten Entwürfe der Zweiten Symphonie an der Elbe. 1907 war die Partitur vollendet, 1908 kam die Symphonie in St. Petersburg zur Uraufführung – und diesmal lauschte das Publikum gebannt – der enormen Länge der Symphonie zum Trotz. Der Symphoniker Rachmaninow war voll rehabilitiert, seine Zweite wurde zu seiner meistgespielten Symphonie.
Wie das Vorgängerwerk beginnt auch diese Symphonie mit einem düsteren Motto – wohl nach dem Vorbild der Tschaikowsky-Symphonien IV und V. Von diesem Motto leitetet sich auch das Hauptthema des folgenden Allegros ab.
Als zweiter Satz folgt ein marschartiges Scherzo, in dessen Hauptthema – wie später noch so oft bei diesem Komponisten, das gregorianische »Dies irae« anklingt. Wie bei Tschaikowsky kehrt auch bei Rachmaninow das Motto aus dem Kopfsatz (in den Blechblasern) mehrmals zurück und sorgt für Irritation. Das Adagio klingt nicht von ungefähr opernhaft: Rachmaninow greift auf Themen aus dem zentralen Duett seiner Oper »Francesca da Rimini« (1904/05) zurück. Ein nervöser Mittelteil stellt nach Zitaten aus dem ersten Satz (Volovioline) das Liebesglück nachdrücklich in Frage.
Das Finale der Zweiten ist ein für diesen Komponisten ungewöhnlich fröhlich wirkender Beschluß, dessen Triolenrhythmus alles mit sich zu reißen scheint, auch formbildenden Reminiszenzen an die vorangegangenen Sätze. Selbst das nachdenkliche Motiv aus dem Adagio läßt sich „überreden“.
DRITTE SYMPHONIE
Drei Jahrzehnte hat sich Rachmaninow nach dem Erfolg der Zweiten Zeit gelassen, ehe er wieder eine Symphonie schrieb. Inzwischen waren die Klavierkonzerte Nr. 3 und (in den USA) Nr. 4 entstanden, die oratorische Symphonie »Die Glocken« nach Gedichten von E. A. Poe und die »Vespermesse«. Seine Klavier-Solowerke hat Rachmaninow um einen zweiten Band von Préludes (op. 32) ergänzt und vor allem um die formal originellen »Etudes-Tableaux«, wobei die Klangsprache immer herber wurde, obwohl sich der romantische Rachmaninow-Tonfall nicht verändert und unverkennbar blieb.
Zwei eindrucksvolle Variationswerke dürfen bei der Betrachtung von Rachmaninows künstlerischem Weg nicht vernachläßigt werden: Die »Rhapsodie über ein Thema von Paganini« (in Wahrheit ein fünftes Klavierkonzert) und die »Corelli-Variationen« für Klavier solo: Hier kultiviert der Komponist eine handwerkliche Meisterschaft im variieren und verarbeiten von Motiven und Themen, erschließt seiner Musik aber auch harmonisch neue Räume. Bei allem romantischem Zungenschlag: Da komponiert ein Zeitgenosse des XX. Jahrhunderts.
Seine Wahlheimat sieht in Rachmaninow den bedeutenden russischen Pianisten und hört am liebsten das frühe Prélude in cis-Moll, gegen dessen Popularität der Komponist bald eine Aversion entwickelt – es wird dennoch nach jedem Recital als Zugabe gefordert!
EIN SPÄTWERK
Die Dritte Symphonie stammt aus Rachmaninows letztem Lebensabschnitt, 1936 vollendet und von Leopold Stokowski mit dem Philadelphia Orchestra uraufgeführt, stößt sie auf Ratlosigkeit. So viel herber, moderner war die Klangsprache als in Rachmaninows so populären Klavierkonzerten und den berühmten Préludes.
Die klaren Schnitte der rasch wechselnden Stimmungen der »Paganini-Rhapsodie« kehren wieder, nun angewandt auf behutsam modellierte Veränderungen innerhalb größerer symphonischer Blöcke. Die Harmonien scheuen vor Dissonanzen nicht zurück. Viel Schlagwerk betont die rhythmischen Kühnheiten und sorgt für aparte klangliche Effekte. Formal experimentiert Rachmaninow mit der Vereinigung der üblichen Mittelsätze einer Symphonie zu einem originellen Pasticcio.
Wie schon die Zweite beginnt auch die Dritte Symphonie mit einem Motto, dessen Melodik nach orthodoxer Psalmodie klingt; dem folgt nach einem kräftigen Orchesteraufschwung ein melancholisch-schönes Hauptthema das oft als Heimweh-Motiv des exilierten Russen gedeutet wurde . . .
Im Mittelsatz verschmelzen Adagio und Scherzo. Im Thema verwandeln Solo-Horn und Harfe das Motto der Symphonie zu einem neuen melodischen Gedanken. Die markigen Rhythmen des Scherzoteils nehmen dann die Kraft und Vitalität des Finalsatzes vorweg, indem der Instrumentationskünstler Rachmaninow ebenso birlliert wie der Tonsetzer: Im Zentrum steht eine virtuos gestaltete Fuge. Wie eine »Idée fixe« drängt sich zwischen die Themen und das Motto – nicht selten bei diesem Komponisten – gregorianische Totensequenz »Dies irae«. Ein mephistophelischer Eishauch bläst über den effektvollen Symphonieschluß.
DIE TONDICHTUNGEN
Auch diese Symphonie beginnt mit einem altrussisch anmutenden Motto; als Hauptthema stellt sich eine melancholische Melodic vor. In ihrer siiBen Wehmut schwingt eine gehorige Dosis Nostalgie im wortlichen Sinne mit; noch jeder russische Emigrant hatte Heimweh . . . Freilich gehorte diese elegische Grundstimmung schon immer zu Rachmaninows Stilpalette und ist ebenso von Tschaikowsky wie von Tschechow vorgepragt. Die Dritte hat nur einen Mittelsatz: Das iibliche Adagio bildet den Rahmen, das >Scherzo< den Mittelteil. Im Adagio-Thema entdeckt man eine Metamorphose des Mottos (Solo-Horn uber Harfenakkorden). Handiest, ja fast barbeiBig fahrt dann das >Scherzo< dazwischen. Seine Vitalitat speist gleichsam das Finale, ein hochvirtuoses Stuck Orchestermusik mit einer spannend aufgebauten Fuge darin. Unter die verschiedenen, meist nur episodischen Themen mischt sich auch wieder jenes Motiv, das bei Rachmaninow fast schon die Bedeutung einer »idee fixe« besitzt die mittelalterliche Totensequenz des »Dies irae«.
DIE TONDICHTUNGEN
»DER FELS«
Rachmaninow war vierzehn Jahr jung, als er seine erste Orchesterpartitur niederschrieb. Doch erst die Tondichtung »Der Fels«, ein Werk des gerade 20jahrigen Absolventen des Moskauer Konservatoriums, erlebte die Drucklegung. Peter Iljitsch Tschaikowsky, er hatte sich zu Studienzeiten Rachmaninows bereits für die Aufführung von dessen Zigeuneroper »Aleko«, eingesetzt, hielt den »Fels«, für bedeutend und sorgte dafür, daß die Kompositionen in der Wintersaison 1893/94 in den Konservatoriumskonzerten erklang. Er sollte die Uraufführung nicht mehr erleben.
Rachmaninow hat seinem Werk ein literarisches Motto aus dem gleichnamigen Gedicht Michail Lermontows vorangestellt
Die kleine goldne Wolke lag die Nacht/An der Brust des riesigen Felsens
Doch hat der Komponist bekannt, zu seiner Musik eher von Anton Tschechows Erzählung »Auf dem Wege« (Na puti) inspiriert worden zu sein, die eine nächtliche Begegnung zwischen einem Mädchen und einem vom Schicksal schwergeprüften älteren Mann zum Inhalt hat.
Den Mann zeichnen zum Auftakt des Werks die kraftvollen Striche von Celli und Bässen – auf dem Hohepunkt der Komposition kehrt dieses Thema schicksalhaft in den BIechbläsern fortissimo wieder. Die wogenden Holzbläserfigruationen hingegen stehen für das Mädchen, das den Erzählungen des Mannes lauscht. Ihr gehört auch das Flotenthema, das suggestive in immer neuen Varianten erscheint und bald in ein breit strömendes Thema verwandelt wird.
»DIETOTENINSEL«
»Lichte, frohliche Farben gelingen mir nichtleicht.« hat Sergej Rachmaninow einmal bekannt. Umso eindringlicher vermochte er die Düsterkeit von Arnold Böcklins Gemälde »Die Toteninsel« in Musik zu setzen. Eine der fünf Varianten, die Böcklin von diesem Thema gemalt hat, nahm Rachmaninow als bildliche Vorlage für seine symphonische Dichtung.
Wieder einmal klingt das »Dies irae« an, diesmal im breiten Strömen des im 5/4-Takt unheimlich schaukelnden Rhythmus, der Charons Nachen zur Toteninsel übersetzen läßt. In einer großen Steigerungswelle erleben wir die Überstellung eines Toten, dessen Schicksal, Freuden und Leidenschaften noch einmal in einem große akustischen Déja-entendu anklingt. Die verzweifelten inneren Kämpfe fruchten wenig: Charon kehrt einsam zum anderen Ufer zurück, um sein nächstes Opfer einzuholen.
Über die leidenschaftliche Es-Dur-Passage im Mittelteil der Komposition schrieb Rachmaninow an den Dirigenten Leopold Stokowski:
Sie soll einen starken Kontrast zum restlichen Stück bilden – schneller, nervöser und emotionsgeladener . . . Bis hier hin regierte der Tod, doch nun regiert das Leben.