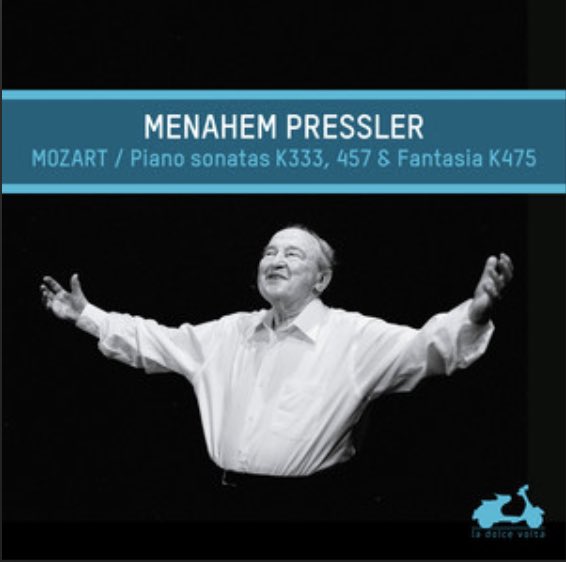für Katrin
Alle Beiträge von sinkothekar
Material Salon schnell
Gruß an Georg!
Georges Pretre
Der Monsieur 100.000 Volt unter den Dirigenten
Er war der elektrisierendste Maestro seiner Zeit. Nicht unschwierig dabei: Nur als Erster Gastdirigent der Wiener Symphoniker hielt er es über eine längere Strecke aus. Doch seine Konzerte sind dem Publikum in lebhafter Erinnerung. Wenn dieser Mann am Pult stand, dann garantierte das Hochspannung – ganz gleich, bei welchem Repertoire.
Georges Pretre weiterlesenJohanna Martzy
1924 – 1979
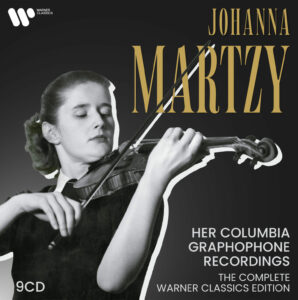
Wer den boomenden Vinylmarkt verfolgt, weiß, daß einige Schallplatten mit Aufnahmen von Johanna Martzy astronomische Preise erzielen. Zu den gesuchtesten Vinyl-Scheiben gehört etwa die Einspielung von Antonín Dvořáks Violinkonzert unter Ferenc Fricsay auf Deutsche Grammophon.
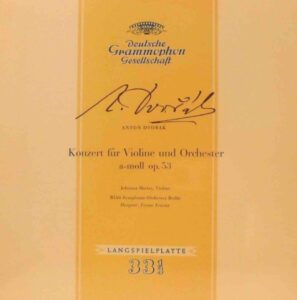
Menahem Pressler und das Beaux Arts Trio
(1923-2023)
Jahrzehntelang war Menahem Pressler der Pianist des weltberümten Beaux Arts Trios und setzte mit den Kollegen Daniel Guilet (1955 – 1968) sowie Isidore Cohen (Violine) und Bernard Greenhouse (Cello) Maßstäbe – auch in zahlreichen Schallplattenaufnahmen.
Im Jahr 2013 kehrte Pressler als Solist aufs Podium des Wiener Konzerthauses zurück. Als Einspringer bescherte er dem Publikum eine veritable Sensation. (ZUR REZENSENSION)
In der Folge nahm der hochbetagte Künstler noch einige Solo-CDs auf, die seinen Rang als Interpret eindrucksvoll unter Beweis stellten, sowohl bei Mozart als auch im impressionistischen Repertoire.
Der Callas Kalender
Maria Callas
Bartók: Blaubart
Kreneks »Orpheus«
Strauss: Intermezzo
Intermezzo
Text und Musik: Richard Strauss (1923)
Hofmannsthal und Herman Bahr winkten ab, so dichtete Richard Strauss den Text zu seiner »Home-Opera« selbst.
Der Briefwechsel zwischen Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal ist voll mit Ermahnungen des Komponisten, der die Suche nach Komödienstoffen und einen leichten Buffo-Tonfall einfordert. Was dem Komponisten vorschwebte, hatte der Dichter nur einmal wirklich realisiert: im nachgelieferten Vorspiel zu Ariadne auf Naxos. Die Mixtur aus Rezitativ und ariosen Einschüben, sogar mit Sprechtexten für einen Schauspieler durchsetzt, schien Strauss vorzüglich gelungen.
Der theatralische Ehekrach
Nun versuchte er, diesen Stil auf einen ganzen Opernabend auszudehnen und befand, sein eigenes Leben sei spannend genug, um ein Musiktheater-Publikum interessieren zu können. Die kapriziöse Ehefrau Pauline hatte ja auch Hofmannsthal als Vorbild für die Färbersfrau in der Frau ohne Schatten genannt. Und Strauss hatte sie als Des Helden Gefährtin schon 1898 in der Tondichtung Ein Heldenleben verewigt. Kurz nach der Jahrhundertwende hatte er sein Familienleben bereits in der Sinfonia domestica zum Klingen gebracht.
Nun fungierte ein – tatsächlich stattgefundener – Ehestreit im Hause Strauss als Ideenbringer für eine Opernhandlung, die in späteren Zeiten eine gute Folge für eine TV-Hauptabend-Komödie hergegeben hätte. Die Opernwelt wollte von solchen realistischen bürgerlichen Selbstbespiegelungen inklusive Rodelbahn auf der Bühne nicht viel wissen. überdies schien der Konversationsstil, den Strauss den Gesangstimmen verordnete doch seine melodische Erfindungsgabe ein wenig gebremst zu haben. Der Komponist selbst hat ihn in späteren Werken nur passagenweise angewendet und erst in seinem Capriccio wieder darauf zurückgegriffen, um ihn mit der Formenwelt der alten Nummernoper zu vermengen.
Symphonische Zwischenspiele
Im Intermezzo setzt die Partitur durchwegs eher auf kleinteilige Charakterisierungskunst als auf große Vokallinie, von den Monologen der Ehefrau Christine und einem grüblerischen Selbstgespräch des verzweifelten, zu Unrecht der Untreue bezichtigten Kapellmeisters Storch bei Gewitter und Sturm in den Praterauen abgesehen.
So blieb Intermezzo ein Stück für geeichte Strauss-Verehrer, die freilich manche Köstlichkeiten in dem Werk entdecken können, die komponierten Kartenpartie am Beginn des zweiten Aktes etwa oder – vor allem – die großen Zwischenspiele, die von einer Szene zur andern überleiten; hier nimmt sich der Symphoniker Strauss Zeit, die Geschichte in Tönen auszuerzählen.


Daß das eine vergnüglich-besinnliche Angelegenheit sein kann, beweisen die wenigen, aber durchwegs künstlerisch hochwertigen Livemitschnitte und Studioproduktion. In Wien fand zum Strauss-Jahr 1964 eine Neuinszenierung im Theater an der Wien mit Hanny Steffek und Hermann Prey statt, die Joseph Keilberth am Pult liebevoll betreute.
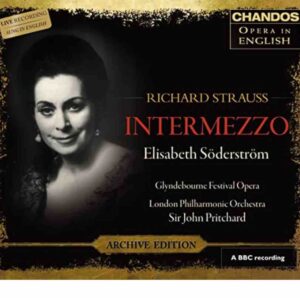
In Glyndebourne sang – für das Konversationsstück folgerichtig auf Englisch – 1974 Elisabeth Söderström die weibliche Hauptrolle wunderschön. Und Wolfgang Sawallisch hat mit Lucia Popp und Dietrich Fischer-Dieskau eine fein geschliffene Studioversion des Stücks für EMI realisiert . Da wird Intermezzo zu einem durchaus amüsant-hintergründigem Hörspiel mit Musik.

Wer die Handlung auch sehen möchte, findet im Netz gewiß den → TV-Mitschnitt der von Joseph Keilberth glänzend dirigierten Münchner Produktion von 1963 (wiederum mit Hanny Steffek und Hermann Prey). Damals hatte man noch den Mut, die szenischen Anweisungen des Komponisten wirklich auf Punkt und Komma umzusetzen – also wird bei Rudolf Hartmann – in einem Bühnenbild von Jean-Pierre Ponnelle! – wirklich gerodelt…