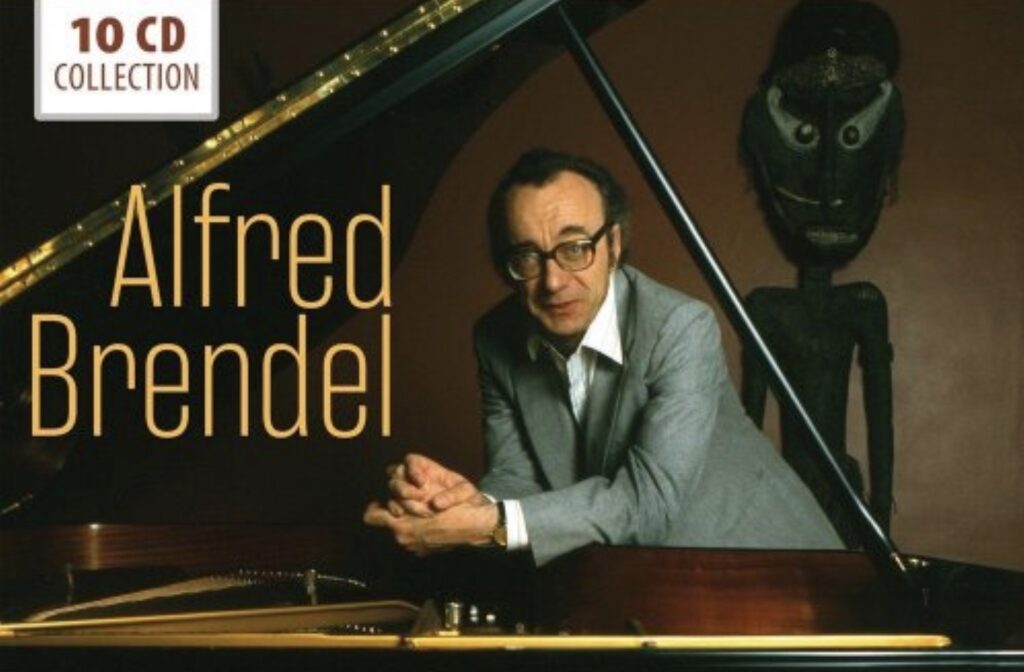Archiv der Kategorie: Nachruf
Roberta Alexander (1949-2025)
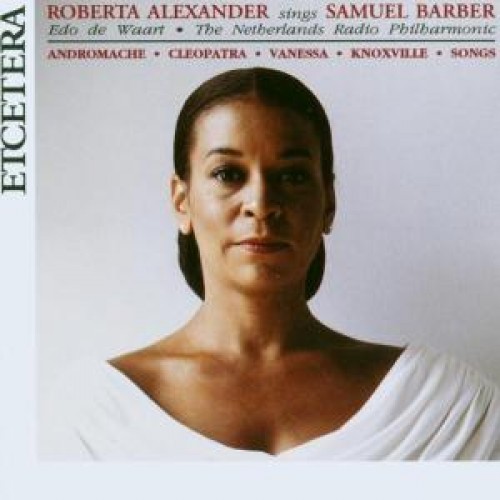
Roberta Alexander war eine der vielseitigsten Sopranistinnen ihrer Generation. Sie arbeitete mit Dirigenten wie Colin Davis oder Bernard Haitink, war aber auch im Ensemble von Nikolaus Harnoncourt, als der daranging, regelmäßig große Opern- und Oratorienaufnahmen zu machen. Viel Aufhebens von ihrer Kunst und ihrer Persönlichkeit hat diese Künstlerin nie gemacht. Umso erstaunlicher ist die Bilanz ihres Wirkens.
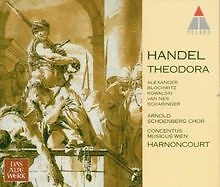
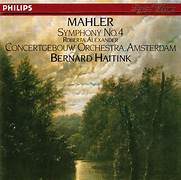
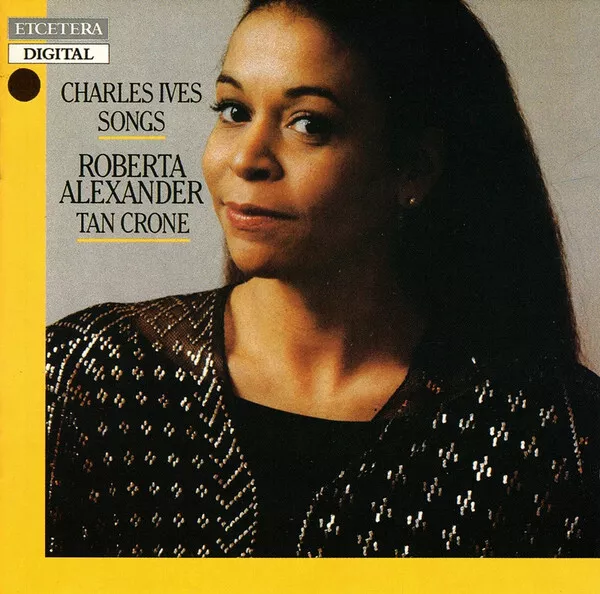
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Zum Tod von Rodion Schtschedrin
Der Komponist, der »Carmen« für die Sowjets neu erfand Rodion Schtschedrin, einst von Dmitri Schostakowitsch gefördert, mit seiner Ballettversion von Bizets »Carmen«-Musik weltberühmt geworden, aber auch stets neugierig, was die musikalische Avantgarde bereithielt, ist 92-jährig in München gestorben.
Die »Carmen« besiegelte seinen Erfolg, und anders als Georges Bizet, der die Grundlage dafür geschaffen hatte, durfte Rodion Schtschedrin die Lorbeeren noch ernten. Wenn auch nach Umwegen. Die legendäre Primaballerina des Moskauer Bolschoitheaters, Maja Plissetskaja, war seine Frau. Für sie schuf er, basierend auf der Musik der populären Oper, ...
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Alfred Brendel
NACHRUF –– WÜRDIGUNGEN –– REZENSIONEN
Weisheit am Klavier
NACHRUF VOM 17. JUNI 2025
In Mähren geboren, in Kroatien und Graz aufgewachsen, nach London ausgewandert: In seinem musikalischen Herzen blieb der Künstler ein Wiener.
Er zog, diese Pointe konnte man sich als Rezensent damals nicht entgehen lassen, als letzten Ton seines unwiderruflich letzten Soloauftritts noch ein As aus dem Ärmel, ein zweigestrichenes As, mit dem er – nach leichter Verzögerung Liszts „Au Lac de Wallenstadt“ beendete. Verschmitzten Blicks, versteht sich. Die scheinbar simple Pointe war, typisch Alfred Brendel, doch vielschichtigen Zuschnitts. Der weltweit hoch verehrte Beethoven- und Schubert-Interpret, hielt die Wiener Klassiker hoch wie kaum ein Zweiter, spielte aber mit derselben Hingabe Liszt und ließ es nicht zu, wenn jemand diesen Komponisten weniger hoch achten wollte.
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Johanna Matz (1932-2025)
Vom allseits geliebten Hannerl zur Thomas-Bernhard-Darstellerin
Johanna Matz starb am selben Tag wie Waltraud Haas. Eine Rolle verhalf beiden zu Kino-Triumphen: Die Wirtin im „Weißen Rößl“. Die Matz vergaß über dem „Hannerl“-Image nie ihren Status als Burg-Schauspielerin.
Hannerl! Nicht von ungefähr hieß der Film über ein Mädchen, das gegen alle Widerstände doch Schauspielerin werden darf, nach der Hauptdarstellerin: Als „Hannerl“ war Johanna Matz in kürzester Zeit zum wienerischen Star geworden. An manchen Abenden konnten die Verehrer gleich drei Filme sehen, wenn Sie durch die Stadt von Kino zu Kino pilgerten: um 16 Uhr den „Zapfenstreich“, um 18 Uhr „Die Försterchristl“ und um 21 Uhr - ja, eben - „Hannerl“. Das war 1952. Ein Jahre später bestand für Kinobetreiber im deutschen Sprachraum kein Zweifel: Hannerl Matz erhielt 80 Prozent aller Stimmen bei der Frage nach der zugkräftigsten Schauspielerin.
Acht Jahre vor Waltraud Haas: die Rößlwirtin
Damals war sie die selbstverständliche Besetzung der „Rößlwirtin“ in Willi Forsts Verfilmung der Operette „Im weißen Rößl“ an der Seite von Johannes Heesters.
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Peter Seiffert ist tot – Der ideale Tenor für Wagner, aber auch für Lehár
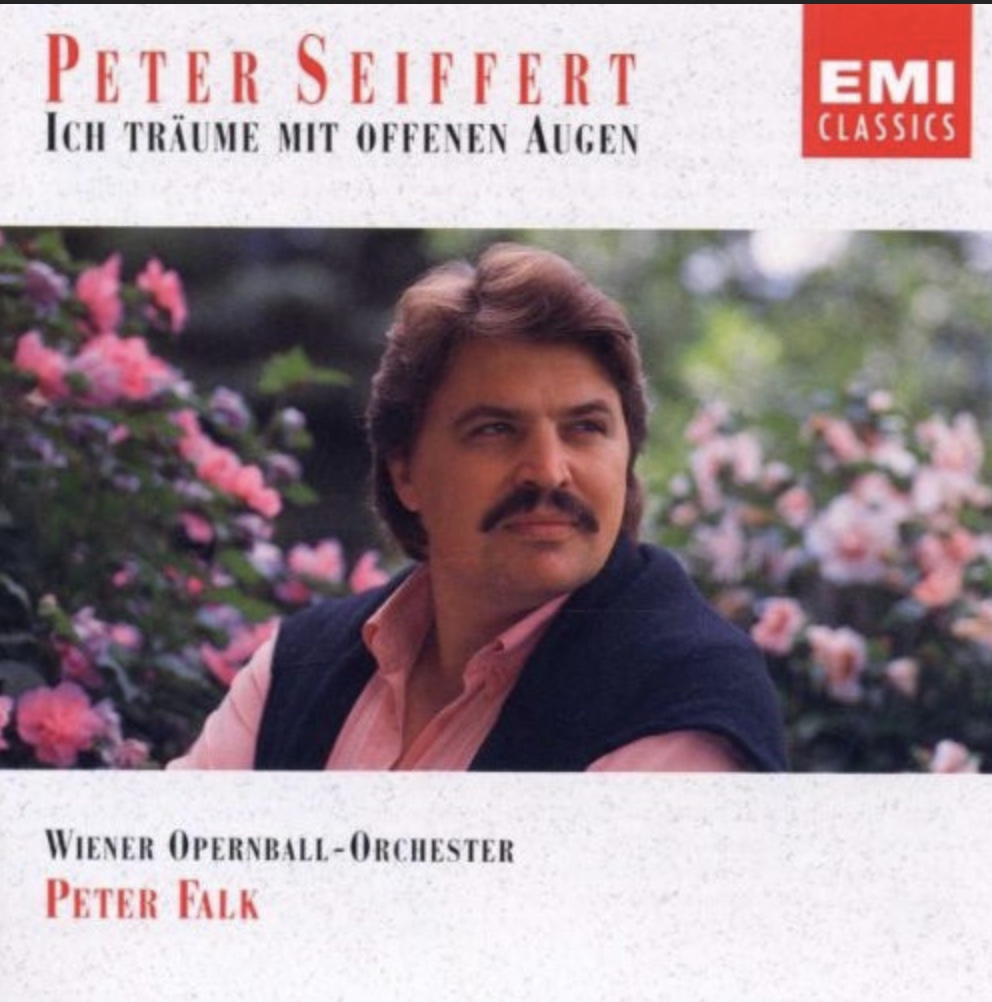
Von der Leichten Muse hat der 1954 in Düsseldorf geborene Tenor bald ins Heldenfach gefunden, ohne den Schmelz seiner Stimme zu verlieren.
„Schön ist die Welt“ – mit seinen ersten Aufnahmen trat der junge Peter Seiffert in die Fußstapfen eines Richard Tauber: Die kraftvolle, leuchtkräftige Stimme war für die sinnlichen Operettenmelodien, die Franz Lehár seinem besten Interpreten in der Gurgel komponiert hatte, ideal geeignet, ebenso geschmeidig wie höhensicher. Und mit einer Lust bei der Sache, dass kein Hörer auf den Gedanken kam, dieser Künstler würde sich nach Auftritten in den großen Opernhäusern oder gar bei den Bayreuther Festspielen sehnen.
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Erinnerungen an Sofia Gubaidulina
SOFIA GUBAIDULINA (1931-2025)
Die Dissidentin, die in Tönen sprach
Als Ideal betrachte ich ein solches Verhältnis zur Tradition und zu neuen Kompositionsmitteln, bei dem der Künstler alle Mittel – sowohl neue als auch traditionelle – beherrscht, aber so, als schenke er weder den einen noch den anderen Beachtung.
Zwischen allen Stühlen, über alle Mittel gebietend, aber nur ihrer eigenen inneren, formenden Stimme folgend, komponierte Sofia Gubaidulina. Sie gehörte keiner Richtung, keinem Clan, keinem »Ismus«. Sie war Sofia Gubaidulina. Und da ihre Musik prominente Fürsprecher gefunden hatte, konnte sich die Welt davon überzeugen, daß diese Komponisten etwas zu sagen hatte.Sie stammte aus Tatarstan, war die Enkelin eines islamischen Imams und studierte in Kasan, dann in Moskau Klavier, bald auch Komposition. Es gelang ihr, allen Anfeindungen zum Trotz - sie hatte sich dem staatlich verordneten Atheismus zum Trotz unter dem Einfluß der Pianistin Maria Yudina zur Orthodoxie bekannt - ab 1963 ausschließlich ihrer schöpferischen Arbeit zu leben.
Zu ihren Inspirationsquellen gehören nicht nur die großen Werke der Vergangenheit, sondern auch die Klangmöglichkeiten, die sich ihr beim Improvisieren auf Instrumenten der Volksmusik unterschiedlicher Regionen der ehemaligen Sowjetunion erschlossen. Obwohl sich von Anfang an viele Musiker fanden, die Gubaidulinas Musik in ihrer Originalität schätzten, wurde sie von den strengen Kunstrichtern des kommunistischen Systems des öfteren mit Aufführungsverboten belegt. Der Weg, den die junge Komponisten eingeschlagen hatte, war in den Augen der sowjetischen Zensur schlicht und einfach »falsch«.
Niemand Geringerer als Dmitri Schostakowitsch ermunterte die offenkundig talentierte junge Kollegin, in ihrem – für das offizielle Kulturbeobachtertum höchst irritierenden, subjektiven – Stil weiterzukomponieren, obwohl die kommunistischen Behörden sie sogleich maßregelten, als klar wurde: Diese Frau schrieb Musik, die weit vom »volksverbundenen« sozialistischen Realismus abwich.
Seien Sie Sie selbst. Haben Sie keine Angst, Sie selbst zu sein. Ich wünsche Ihnen, daß Sie auf ihrem eigenen »falschen Weg« weitergehen mögen.
JENSEITS DES »SOZIALISTISCHEN REALISMUS«

Gubaidulina pflegte ihren ganz persönlichen Kontakt zu den Wurzeln der vielfältigen Volksmusik der Menschen, die im sowjetischen System unter ein einheitliches Joch gezwungen wurden, improvisierte mit Gleichgesinnten auf Volksinstrumenten und erkundete die freie, weite, unendlich reiche Welt der Klänge. Sie beflügelten ihre Fantasie ebenso wie die spirituellen Erfahrungen, die sie als sensible Grenzgängerin zwischen den Religionen machen konnte: Eines Tages ließ sich die Enkelin eines islamischen Gelehrten taufen – die große Pianistin Maria Judina war ihre Patin, eine starke Frau auch sie, die Stalin zu trotzen wagte, ohne daß der Diktator aufhörte, sie als Künstlerin zu verehren…
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Zum Tod von Edith Mathis
Eine Sopranstimme voll unschuldiger Schönheit
Die Schweizer Sängerin starb 86-jährig. Daheim auf den großen Opernbühnen der Welt, war sie für Karajan, Böhm, Bernstein und Kleiber erste Wahl. Sie sang unvergleichlich rein und klar Mozart bei den Salzburger Festspielen. Führende Komponisten schufen neue Opernpartien für sie.
In Zeiten des Wirtschaftswunders gehörte sie zum internationalen Traum-Ensemble, das stilbildend wirkte: Edith Mathis war dabei, wenn Karl Richter Bach aufnahm, Herbert von Karajan Haydns „Schöpfung“, Carlos Kleiber Webers „Freischütz“ oder Karl Böhm Mozarts „Figaro“ - mit Gundula Janowitz, Hermann Prey und Dietrich-Fischer-Dieskau, in einer Konstellation also, die sich in der Opernrealität schon deshalb kaum je ergeben konnte, weil die beiden Herren nicht miteinander konnten.
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Zum Tod von Peter Schmidl
Der philharmonische Soloklarinettist starb 84-jöhrig Sein Spiel hat mindestens eine Generation von Wiener Musikfreunden fürs Leben geprägt: So musste eine Klarinette in Wien klingen! Heller, doch satter Ton, geschmeidige, doch rhythmisch prägnante Phrasierung – nachzuhören etwa in der Aufnahme des Mozart-Konzerts mit seinen philharmonischen Kollegen unter Leonard Bernstein. Mit Peter Schmidl ist am vergangenen Samstag eine Musikerlegende gestorben.
Zur Welt gekommen war Schmidl im mährischen Olmütz am 10. Jänner 1941. Vater und Großvater waren bereits Soloklarinettisten der Wiener Philharmoniker gewesen. Peter Schmidl machte zunächst zwar ei...
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN
Zum Tod von Otto Schenk
Regie aus Liebe zur Musik
Zum absoluten Publikumsliebling war der junge Otto Schenk bereits geworden, weil er in der Frühzeit des Fernsehens im Verein mit seinem kongenialen Schauspielerkollegen Alfred Böhm für die damals noch künstlerisch als Kabarett-Sketch gestaltete Werbung eines Elektronik-Konzerns den »Untermieter» spielte. Darauf wartete man und lernte einen genialen Komödianten lieben.
»Der Schenk hilft!«
Bald waren sich auch die Kollegen einig: Otto Schenk war nicht nur ein exzellenter, wandlungsfähiger Schauspieler. Er war zum Regieführen begabt, weil er sich in Rollen und Stücke einfühlen konnte wie kein zweiter und weil er imstande war, Kollegen, denen das nicht in die Wiege gelegt war, auf den rechten Weg zu bringen. »Der Schenk hilft«, hieß es. Schenk half – oft auch hinterrücks, wenn der eigentliche Regisseur gerade nicht dabei war. Und irgendwann ließ es sich nicht vermeiden: Man engagierte ihn gleich als Spielmacher.
WIE OTTO SCHENK ZUR OPER KAM
Es hat nicht lang gedauert, da inszenierte Schenk, der es im Sprechtheater immerhin bis zum Schauspielchef der Salzburger Festspiele brachte – auch Oper. Ewar ein großer Komödiant im umfassendsten Sinn des Wortes. Und weil er Musik liebte, inszenierte er auch leidenschaftlich gern Opern. Und das von der Wiener Staatsoper bis an die New Yorker Met. Die Siebziger- und Achtzigerjahre waren seine geschäftigste Musiktheater-Ära.
MAN SCHALT IHN »ALTMODISCH«
Er blieb dabei stets ganz nah am Text, lauschte der Musik und tat jedenfalls nichts, was Melodien und Harmonien einer Partitur zuwiderlief. Hie und da war vielleicht zu viel los auf der Bühne, hie und da auch – wenn die Darsteller nicht ganz so talentiert waren – schien es, es liefen etliche Schenk-Kopisten auf der Szene herum. Aber seinem Bekenntnis, er wolle realistisches Theater machen, und was ihm dabei nicht gelinge, sei ihm »Verfremdung genug«, dem blieb er treu. Auch, als die Rezensenten begannen, die »Verfremder« in den Himmel und ihn in die Hölle zu schreiben.
ZUM WEITERLESEN, BITTE ANMELDEN