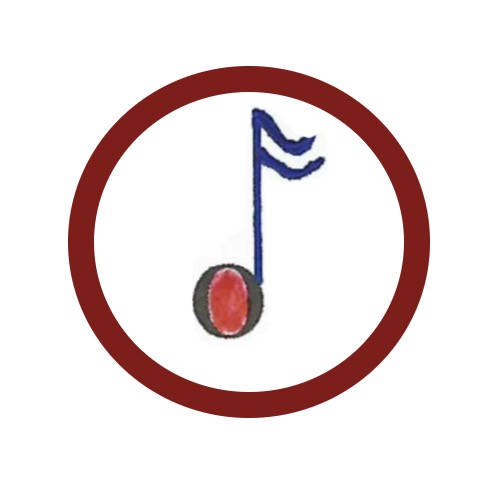Emmanuel Tjeknavorian zu Gast im Klassik-Treffpunkt (Ö1, 10.05 Uhr)
Archiv der Kategorie: Kalender
Leontyne Price zum Geburtstag
Die Sendung auf Ö1 (14.05 Uhr)
Wien – Paris – Köln
Ein Wiener Ensemble gewährt uns heute Einblick in die Vielfalt der französischen Musik im Ancien régime. Und zwar im Rahmen eines Konzerts, das der WDR live aus Köln überträgt (20.04 Uhr). Das kam so: Das Ensemble Freymut, gegründet in Wien, nahm im Sommer vorigen Jahres am »Internationalen H.I.F. Biber-Wettbewerb« im oberösterreichischen Augustiner Chorherrenstift St. Florian teil und gewann dort den Sonderpreis des WDR. Der Lohn dafür: Das 2018 in Wien gegründete Barockmusik-Ensemble gastiert im Verein mit der Sopranistin Johanna Falkinger heute in Köln und musiziert im dortigen Funkhaus ein rein französischen Programm.
Wien – Paris – Köln weiterlesenModerne für Nachtschwärmer
Für Nachtschwärmer
Kurz nach Mitternacht, also eigentlich schon am 9. Februar, sendet das Bayerische Fernsehen die Aufzeichnung eines interessant programmierten Konzerts der Salzburger Camerata unter Hartmut Haenchen, das Symphonien von Mozart (eine frühe und die allerletzte, die »Jupiter-Symphonie«) einem Werk von Karl Amadeus Hartmann gegenüberstellt.
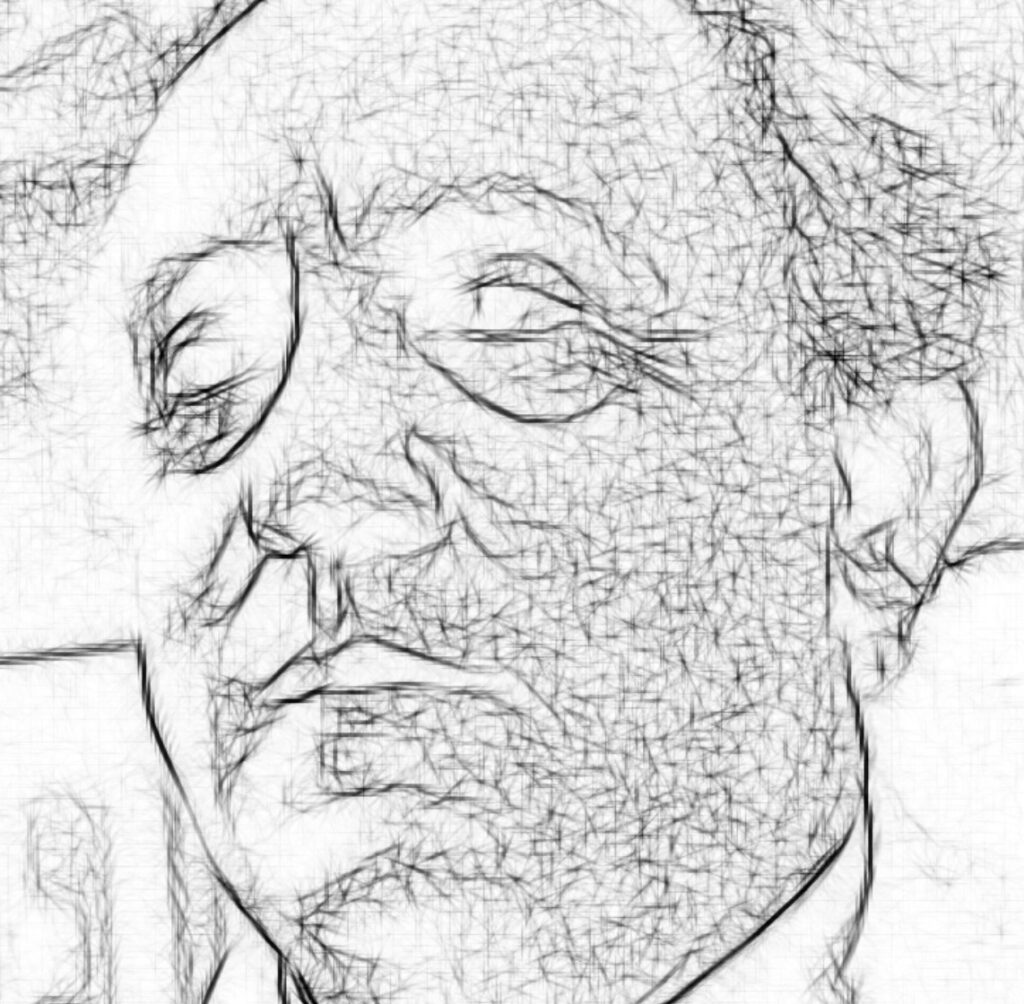
Das Schaffen dieses bedeutenden Symphonikers ist auf CD zwar recht gut, in Video-Mitschnitten aber kaum dokumentiert. Umso spannender, ein Werk zu erleben, in dem der große Expressionist unter den deutschen Komponisten der Ära nach 1945 sich an die spritzig-dialogische Schreibweise der klassischen Sinfonia Concertante anzunähern versuchte.
Das Kammerkonzert für Klarinette, Streichquartett und Streichorchester bildete das Zentrum des Konzerts, das beim Mozartfest Würzburg 2018 aufgezeichnet wurde.
Mehr über Karl Amadeus Hartmann
Puccinis »Manon« im Stream
Staatsoper live. Aus Wien kommt heute via Online-Plattform staatsoperlive.com eine Aufführung von Giacomo Puccinis
Die Produktion ist ein Erbstück der Ära Holender, eine der dümmsten Entstellungen einer Opernhandlung, die in Wien je zu sehen waren. Manon verdurstet allen Ernstes in einem Warenhaus – Kommentar überflüssig.
Interessant aber die Besetzung: Asmik Grigorian ist die Titelheldin, Bryan Jadge der Des Grieux, dazu Boris Pinkhasovich und Josh Lovell – die Musik kann die Szenerie zwar nicht vergessen machen, aber vielleicht fokussieren die Streaming-Kameras ja hie und da darstellerische Qualitäten im Detail. Damit wären Konsumenten, die eine Staatsopern-Aufführung via Internet daheim erleben im Vorteil…
Tebaldi im Portrait
Heute (15.05 Uhr) sendet Ö1 den zweiten Teil des akustischen Portraits der Diva Renata Tebaldi. Teil 1 war am 100. Geburtstag der Künstlerin, dem 1. Februar, Livemitschnitten aus der New Yorker Met gewidmet. Die Sendung ist noch zwei Tage lang nachzuhören.
Im heutigen zweiten Teil des Portraits erklingen Ausschnitte aus den legendären Studio-Aufnahmen mit Mario del Monaco gewidmet. Mehr über Renata Tebaldi hier.
Grigorian in London
Jenufa aus Covent Garden
„Jenůfa“ von Leoš Janáček galt im vergangenen Oktober Asmik Grigorians Debüt an Londons erstem Opernhaus . Die litauische Sopranistin ist mit ihrem Debüt als Salome bei den Salzburger Festspielen 2018 zu einer der führenden Operninterpretinnen auf den internationalen Bühnen geworden. Im Sommer 2021 erschien sie erstmals auf dem „Grünen Hügel“ und sang die Senta in Wagners „Fliegendem Holländer“. der Einstand in Covent Garden als Jenůfa folgte im Oktober .
Bayern 4 sendet die Aufzeichnung der Premiere heute ab 19.05 Uhr
Tanzende Damen
Ein ganz tänzerisches Programm hat sich das NDR-Orchester für seinen heutigen Auftritt zur Feier des fünften Geburtstags der Elbphilharmonie Hamburg ausgesucht. VIa NDR-Radio kann man live dabe sein (20 Uhr), wenn Nathalie Stutzmann Werke von Antonín Dvořák und Maurice Ravel dirigiert. Die 56-jährige Französin, die als Altistin begonnen hatte, nachdem sie ihre Enttäuschung über ihre nach eigener Meinung »viel zu tiefe Stimme« überwunden hatte, widmet sich seit 2009 mehr und mehr dem Dirigieren. Sie bittet die junge deutsche Geigerin Veronika Eberle aufs Podium.
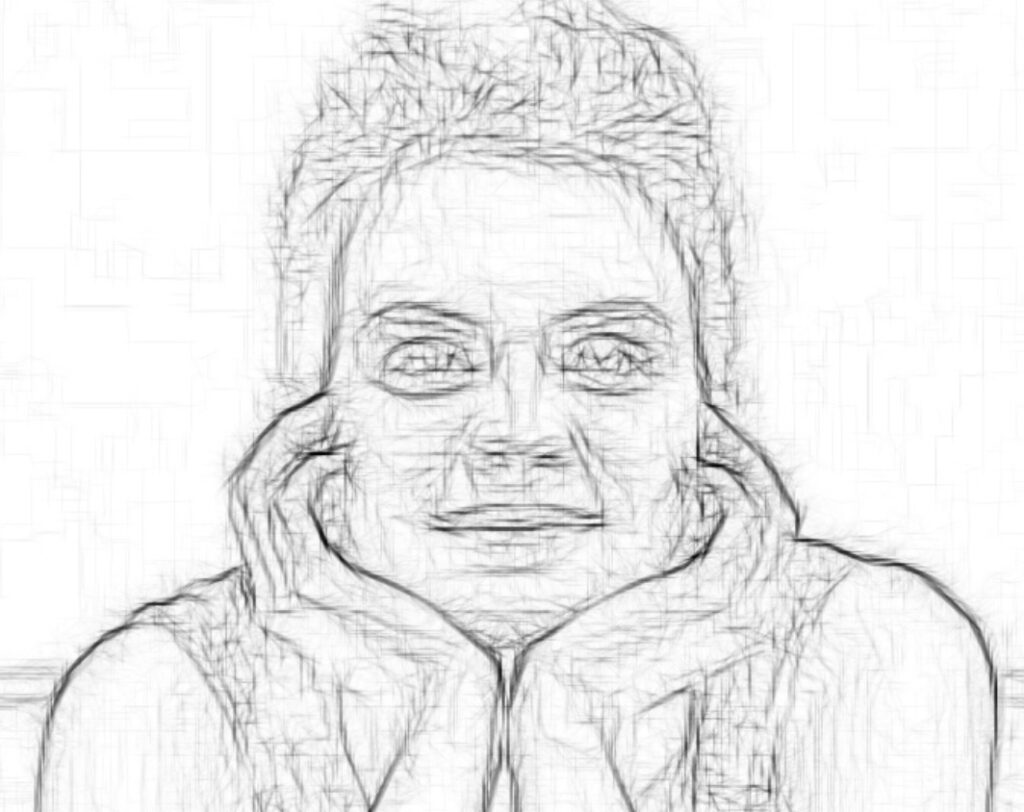
- Antonín Dvořák:
- Drei Slawische Tänze
- Violinkonzert a-Moll op. 53
- Maurice Ravel:
- Valses nobles et sentimentales
- Boléro
Das Programm hat insofern Charme, als es durch und durch vom Tanz inspiriert ist. Ravels »Valses nobles et sentimentales« – der Titel ist eine direkte Anspielung auf Schubert! – reflektieren die Wiener Biedermeier-Tanzidylle samt ihren doppelten und dreifachen Böden: Im Finale treiben die einzelnen Motive der Walzer, die sich zuvor wirbelnd gesteigert hatten, einen geheimnisvoll irrlichternden Spuk. Den Boléro muß man nicht vorstellen, ein gigantisches, ununterbrochenes Crescendo in Form einer genialen Instrumentationsübung. Und Dvořáks Violinkonzert, von höchst dramatischem Zuschnitt zu Beginn, melancholisch verschattet im Mittelsatz, strebt im Finale der Apotheose eines slawischen Tanzes zu – ein brillantes Stück für eine brillante junge Geigerin, die dankenswerterweise einmal nicht Beethoven, Brahms oder Tschaikowsky gewählt hat…
NDR Stream (20 Uhr)
Pianist zu entdecken
LIVE-STREAM

Pavel Kolesnikov in London
Gibt es das »ganz normale« Konzertprogramm? Vor einigen Jahren hätte man vielleicht noch gesagt: Ja, ein Pianist nehme etwa Klaviersonaten von Mozart, Beethoven und Schumann, fertig ist das Recital. Mutige stellten dann vielleicht noch ein modernes Werk ins Zentrum – das nannte man dann Sandwich-Programm. Es war eine Zeitlang in Mode.
Junge Künstler in unseren Tagen neigen mehr und mehr dazu, ganz spezielle Programm-Ideen zu realisieren. Das hat nicht nur mit dem Wunsch zu tun, Aufmerksamkeit zu heischen. Es knüpft auch an frühere Zeiten an, in denen es ganz selbstverständlich war, auch nur Teile, einzelne Sätze aus Symphonien, einzelne Arien aus Opern – und das oft in ein und demselben Programm – zu präsentieren.
Insofern blickt der russische Pianist Pavel Kolesnikov mit seinem heutigen Recital in der Londoner Wigmore Hall in die Vergangenheit wie in die Zukunft. Er wählt Franz Schuberts lange, oft als »Fantasie-Sonate« bezeichnete G-Dur-Klaviersonate als Klammer. Zwischen dem ersten Satz und drei übrigen Sätzen erklingen kürzere Stücke französischer Meister von Couperin bis Reynaldo Hahn.
Musikfreunde können da also nicht nur einen der hoch gehandelten Favoriten auf einen Spitzenplatz in den Klassik-Rankings der kommenden Jahre kennenlernen – Kolesnikov hat etliche Preise gewonnen und wurde von der BBC längst zu einem der vielversprechendsten Talente gekürt, sondern auch Musik von in unseren Breiten kaum beachteten Komponisten.
Der Streaming-Dienst der Wigmore Hall bringt das Konzert live zu uns. Beginn ist um 20 Uhr Londoner Zeit, in Mitteleuropa also um 21 Uhr.
Agitation, symphonisch
Hanns Eisler hat es geschafft, vom Schüler Arnold Schönbergs zu einem komponierenden politischen Aktivisten zu werden – und sich durchaus zur Verwunderung seines Lehrers für den Kommunismus zu engagieren. Den Anspruch, hoch komplexe Partituren zu schreiben, hat er deshalb nicht aufgegeben. Zum Fünf-Jah-Jubiläum der Eröffnung des Hauses, nahm man in der Hamburger Elb-Philharmonie die Deutsche Symphonie Eislers ins Programm, ein ehrgeiziges, abendfüllendes Werk einzigartigen Zuschnitts.
Ö1 überträgt die Aufzeichnung heute um 19.30 Uhr
»Die Lotosblume«
Die Lotosblume ängstigt sich vor der Sonne Pracht / Der Mond, der ist ihr Buhle / Sie duftet und weinet und zittert vor Liebe und Liebesweh
Heinrich Heine
Ein Konzertabend für Neugierige, via NDR-Radio zu empfangen: Der lettische Dirigent Kaspars Putniņš leitete ein Konzert des glänzenden NDR-Vokalensembles mit einem Programm, das in einer musikalischer Meditation über den Anblick einer Lotosblume zum imaginären »Dialog der Kulturen« werden sollte. Angeregt von Robert Schumanns Vertonung von Heinrich Heines Gedicht »Die Lotosblume«, komponierte der japanische Zeitgenosse Toshio Hosokawa eine eigene musikalische Variante des lyrischen Themas. Hosokawa gehört zu den meistgespielten Komponisten unserer Zeit, seine Melange aus fernöstlicher Klangtradition und westlicher »Klassik« zeitigt schillernde Büten; diesfalls Lotosblüten, die Heines Verse um buddhistische Gedanken bereichern.
Gelegenheit auch, romantische Chormusik – unter anderem von Johannes Brahms – kennenzulernen. Der etwas andere Konzertabend, aufgenommen im November 2021, hier im Stream (20.57)