Der Schwierige
Versuch über das Phänomen Carlos Kleiber
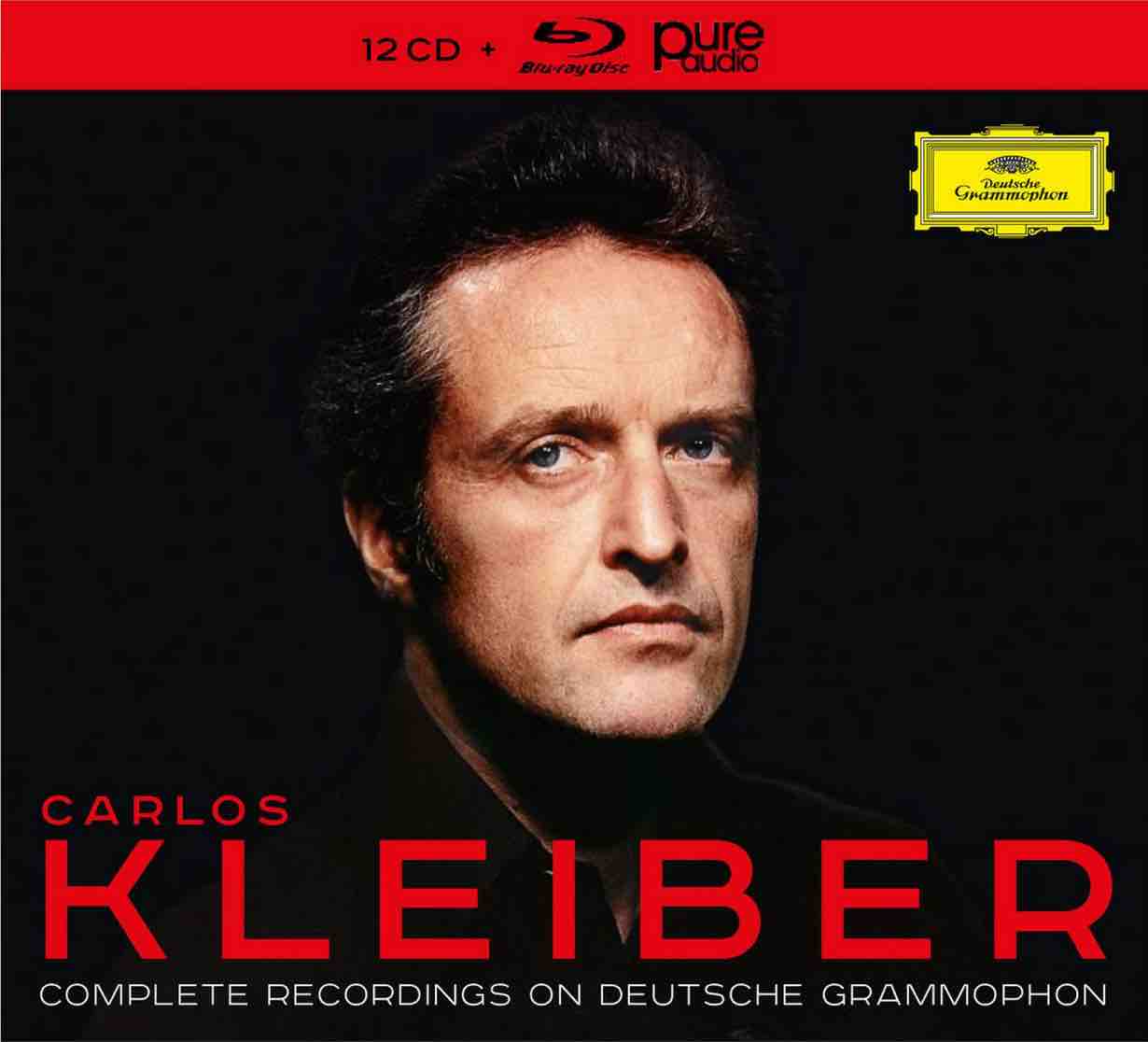 Die Musikwelt wartete und wartete. Sie zehrte von grandiosen Erinnerungen und den spärlichen regulären und auch nur dünn gesäten, ganz und gar illegalen Livemitschnitten. Sie überlegte vielleicht, wieso manches, was in Musikverein oder Staatsoper oder im Münchner Nationaltheater so elektrisierend geklungen hatte via Konserve an Energiepotential einbüßte und manches unverändert mitreißend oder niederschmetternd oder beflügelt-beflügelnd klang.
Die Musikwelt wartete und wartete. Sie zehrte von grandiosen Erinnerungen und den spärlichen regulären und auch nur dünn gesäten, ganz und gar illegalen Livemitschnitten. Sie überlegte vielleicht, wieso manches, was in Musikverein oder Staatsoper oder im Münchner Nationaltheater so elektrisierend geklungen hatte via Konserve an Energiepotential einbüßte und manches unverändert mitreißend oder niederschmetternd oder beflügelt-beflügelnd klang.
Mit solchen theoretischen Überlegungen war beschäftigt, wer Carlos Kleiber verehrte. Also so gut wie alle Musikfreunde, denn, Hand aufs Herz, wer verehrte und verehrt ihn nicht? Zu Lebzeiten des Künstlers war seine Fangemeinde ein Verein von Hoffnungslosen. Daß aus der gar nicht grauen, sondern bunten, lebendigen Theorie wieder einmal Praxis werde könnte, an dieser Aussicht hielten in den letzten Lebenjahren Carlos Kleibers nur noch die besonders Unentwegten fest.
Sie buchten dann, wenn es doch wieder einmal so weit war, Flüge nach Gran Canaria oder sonstwohin, wo der Maestro alle heiligen Zeiten, wie Spötter sagen »irrtümlicherweise«, doch auftait; meist mit dem Bayerischen Staatsorchester oder dem wunderbaren Rundfunksymphonieorchester aus München. Oder sie erzählten von einem Abstecher, den der Vielgeliebte nach Laibach unternahm um mit den dortigen Philharmonikern Brahms aufzuführen.
Dann wurde gemunkelt von aberwitzig hohen Gagen oder davon, daß Carlos Kleiber sein Salär wohltätigen Zwecken zur Verfügung stellte, oder daß er mit einem Luxusauto samt allen Extras entlohnt wurde und natürlich, daß das Konzert unvergleichlich gewesen war.
Selten ist ein nachschaffender Künstler schon zu Lebzeiten von einer solchen Aura der glücklichen Erinnerungen umgeben gewesen. Selten auch hat einer so konsequent daran gearbeitet und damit seinen Marktwert so lange ins Unendliche gesteigert, bis er auf diesem Markt zur irrealen Größe geworden war.
In Wien kann man auch lange nach Kleibers Tod Operntitel wie »Carmen«, »Tristan und Isolde« und »Rosenkavalier« nicht aussprechen, ohne daß der Name Kleiber wie eine Bordunsaite automatisch mitschwänge.
Mit symphonischen Werken wie Brahms' Zweiter oder Vierter, mit den Fragmenten aus Alban Bergs Wozzeck ist es nicht anders.
Das wird so bleiben, solange es genügend Musikenthusiasten gibt, die dabei waren, als der Magier tatsächlich leibhaftig am Pult des Hauses am Ring oder → im Musikverein erschien und zauberte, elegant, nervös, bis in die Fingerspitzen mit äußerster Sensibilität aufgeladen und diese unirdisch sicher auf eine Hundertschaft von Musikanten übertragend.
Zu Lebzeiten war Carlos Kleiber bereits geworden, was er bis heute ist: eine mythologische Gestalt in seltsamer Mischung aus genialischer Größe und Verweigerung.
 Für die »Nachgeborenen«: Die allerschönste Kleiber-Erinnerung bleibt wohl seine idiomatisch schlafwandlerisch »richtige"«, an Hofmannsthals wienerischem Text Maß nehmende Interpretation des »Rosenkavalier«, dessen Wiener Aufnahme - anders als etwa jene der nicht minder legendären Premiere von Bizets »Carmen« - nicht durch eine qualitativ allzu ungleichgewichtige Sängerbesetzung gestört ist.
Für die »Nachgeborenen«: Die allerschönste Kleiber-Erinnerung bleibt wohl seine idiomatisch schlafwandlerisch »richtige"«, an Hofmannsthals wienerischem Text Maß nehmende Interpretation des »Rosenkavalier«, dessen Wiener Aufnahme - anders als etwa jene der nicht minder legendären Premiere von Bizets »Carmen« - nicht durch eine qualitativ allzu ungleichgewichtige Sängerbesetzung gestört ist.