Christa Ludwig
Große Kunst und Sonne im Gemüt
Ach was, das ist die Lust am eigenen Geschrei - so einen Satz kann man von ihr hören, wenn man gerade versucht, in Erinnerungen zu schwelgen. Das ist typisch für Christa Ludwig und ihre "Selbsteinschätzung", die stets von Humor und einer perfekt geerdeten Lebensfreude getragen ist. Auf das Wort Geschrei käme wohl außer ihr selbst niemand, um einen Gesang zu charakterisieren, der ein halbes Jahrhundert lang das Publikum in der gesamten Opern- und Konzertwelt derart begeistert hat.
Gewiß, leise und verhalten waren die Momente nicht, von denen wir gesprochen hatten, als der erstaunliche Satz fiel.
Insofern hatte sie schon recht.
Es ging um jene Passage unmittelbar nachdem sie als Wagners Ortrud im Lohengrin die "Entweihten Götter" angerufen hatte; da brach in der Staatsoper regelmäßig ein Jubel aus, der die Dirigenten - selbst einen Karl Böhm, erst recht den jungen Zubin Mehta - dazu zwang, die Vorstellung zu unterbrechen.
Die Lust an diesem Geschrei war offenkundig allseitig. Der Ludwig machte es Spaß, nachdem sie gerade mit Sirenentönen die unschuldige Elsa von Brabant in ihr Intrigenspiel eingelullt hatte, die schwarze Seele der Ortrud zu offenbaren, herauszuschreien, nein, eben nicht: herauszusingen.
Singen konnte diese Frau wie kaum eine andere; man möge das in jeder Bedeutung des Ausdrucks "singen können" verstehen. Das Verströmen einer herrlichen, edel timbrierten Stimme ist damit gemeint - und das technische Vermögen, dieses unbeschadet über Jahrzehnte hin zu tun.
Oder beinah unbeschadet - es gab ein, zwei kleine, aber berüchtigte Dellen in der Ludwig'schen Biografie. Vor allem ihr Abgang aus Salzburg nach der Premiere von Verdis Don Carlos unter Herbert von Karajan, 1975. Da war ein Ton in der großen Arie der Eboli gekippt. Ein Ton!
Die Künstlerin kommentierte das später ganz kühl - auch in ihrem jüngsten, von Erna Cuesta und Franz Zoglauer mit spürbar viel Zuneigung notierten Buch, "Leicht muß man sein" (Amalthea Verlag). Vor allem zieht sie Vergleiche mit den Leistungen mancher Kolleginnen, die weiß Gott oft mehr als einen Ton in Schieflage bringen, ohne daß die Opernwelt deshalb unterzugehen drohte.
Das stimmt ja: Alle, aber auch wirklich alle anderen Erinnerungen, viele unzählige Erinnerungen an Christa Ludwig erfüllen ihr Publikum mit Dankbarkeit.
Von der furiosen Ortrud war schon die Rede, von der unerbittlichen "Walküren"-Fricka muß die Rede sein. Sie definierte am Wendepunkt der "Ring"-Tragödie die Fallhöhe, aus der die folgenden zehn musikdramatischen Stunden folgerichtig hinabstürzen mussten.
Ein zerrüttetes Seelenprotokoll wie jenes der Klytämnestra war in den letzten Jahren der Laufbahn zur Paraderolle dieser grandiosen Gestalterin geworden; herrlich hintergründige Komödiantik wie jene in Mozarts Cosi fan tutte hatte die Anfangsjahre dominiert: Dorabella firmiert in den Annalen der Wiener Staatsoper als die meistgesungene Ludwig-Partie.
Im zweiten der Erinnerungsbücher, die Christa Ludwig geschrieben hat, erfahren wir auch, daß das die einzige Rolle war, vor der die Sängerin "nie Angst" empfunden hat.
Anders die Brangäne in Wagners Tristan: An der New Yorker Metropolitan Opera sagte sie acht geplante Vorstellungen ab - "ich wollte mich nicht mehr so ängstigen". Da staunt man, gehören doch gerade die auf Tonträgern dokumentierten Interpretationen dieser Partie, allen voran die magischen "Wacherufe", zu den Aufnahmen, die man Musikfreunden, die diese Sängerin nicht mehr live erleben durften, besonders ans Herz legen würde.
Wohl weil man auch zu fühlen meint, warum Karajan und Bernstein und auch Böhm - sie war ja die einzige Sängerin der Welt, die zu allen dreien eine herzliche Beziehung pflegte - von ihr irgendwann einmal auch die Isolde auf der Bühne hören wollten. - Wie sie einst nach reiflicher Überlegung zur Telefonzelle ging, um Bernstein nach langem Hin und Her doch abzusagen, hat die Ludwig oft erzählt.
Nun haben wir noch gar nicht von der begnadeten, weil auch unvergleichlich klar artikulierenden Liedgestalterin gesprochen - aber beim "Nachhören" der gottlob zahlreichen Aufnahmen, die sich in jeder gut sortierten Diskothek finden müssen, stößt man nebst Juwelen wie Otto Klemperers Aufnahme von Mahlers Lied von der Erde wohl auch auf die Winterreise mit James Levine - von einer hymnischen Kritik Joachim Kaisers animiert, hat die Sängerin, die ihre eigenen Aufnahmen nicht sammelt, sich die CD besorgt, abgehört und dann befunden: "Es interessiert mich nicht mehr."
Sie darf das. Sie kann das.
Wir können es nicht. Wir lauschen - und empfinden nach wie vor die unbändige Lust an ihrem Gesang. Und freuen uns überdies, die Künstlerin, wenn schon nicht fasziniert von eigenen Aufnahmen, zumindest nach wie vor interessiert am Fortgang der Gattung Oper zu sehen - und ihr zum unglaublichen Neunziger noch viele Jahre angstfreier Besuche ihrer Opern- und Festspielhäuser zu wünschen!
Gewiß, leise und verhalten waren die Momente nicht, von denen wir gesprochen hatten, als der erstaunliche Satz fiel.
Insofern hatte sie schon recht.
Es ging um jene Passage unmittelbar nachdem sie als Wagners Ortrud im Lohengrin die "Entweihten Götter" angerufen hatte; da brach in der Staatsoper regelmäßig ein Jubel aus, der die Dirigenten - selbst einen Karl Böhm, erst recht den jungen Zubin Mehta - dazu zwang, die Vorstellung zu unterbrechen.
Die Lust an diesem Geschrei war offenkundig allseitig. Der Ludwig machte es Spaß, nachdem sie gerade mit Sirenentönen die unschuldige Elsa von Brabant in ihr Intrigenspiel eingelullt hatte, die schwarze Seele der Ortrud zu offenbaren, herauszuschreien, nein, eben nicht: herauszusingen.
Singen konnte diese Frau wie kaum eine andere; man möge das in jeder Bedeutung des Ausdrucks "singen können" verstehen. Das Verströmen einer herrlichen, edel timbrierten Stimme ist damit gemeint - und das technische Vermögen, dieses unbeschadet über Jahrzehnte hin zu tun.
Oder beinah unbeschadet - es gab ein, zwei kleine, aber berüchtigte Dellen in der Ludwig'schen Biografie. Vor allem ihr Abgang aus Salzburg nach der Premiere von Verdis Don Carlos unter Herbert von Karajan, 1975. Da war ein Ton in der großen Arie der Eboli gekippt. Ein Ton!
Die Künstlerin kommentierte das später ganz kühl - auch in ihrem jüngsten, von Erna Cuesta und Franz Zoglauer mit spürbar viel Zuneigung notierten Buch, "Leicht muß man sein" (Amalthea Verlag). Vor allem zieht sie Vergleiche mit den Leistungen mancher Kolleginnen, die weiß Gott oft mehr als einen Ton in Schieflage bringen, ohne daß die Opernwelt deshalb unterzugehen drohte.
Das stimmt ja: Alle, aber auch wirklich alle anderen Erinnerungen, viele unzählige Erinnerungen an Christa Ludwig erfüllen ihr Publikum mit Dankbarkeit.
Von der furiosen Ortrud war schon die Rede, von der unerbittlichen "Walküren"-Fricka muß die Rede sein. Sie definierte am Wendepunkt der "Ring"-Tragödie die Fallhöhe, aus der die folgenden zehn musikdramatischen Stunden folgerichtig hinabstürzen mussten.
Ein zerrüttetes Seelenprotokoll wie jenes der Klytämnestra war in den letzten Jahren der Laufbahn zur Paraderolle dieser grandiosen Gestalterin geworden; herrlich hintergründige Komödiantik wie jene in Mozarts Cosi fan tutte hatte die Anfangsjahre dominiert: Dorabella firmiert in den Annalen der Wiener Staatsoper als die meistgesungene Ludwig-Partie.
Im zweiten der Erinnerungsbücher, die Christa Ludwig geschrieben hat, erfahren wir auch, daß das die einzige Rolle war, vor der die Sängerin "nie Angst" empfunden hat.
Anders die Brangäne in Wagners Tristan: An der New Yorker Metropolitan Opera sagte sie acht geplante Vorstellungen ab - "ich wollte mich nicht mehr so ängstigen". Da staunt man, gehören doch gerade die auf Tonträgern dokumentierten Interpretationen dieser Partie, allen voran die magischen "Wacherufe", zu den Aufnahmen, die man Musikfreunden, die diese Sängerin nicht mehr live erleben durften, besonders ans Herz legen würde.
Wohl weil man auch zu fühlen meint, warum Karajan und Bernstein und auch Böhm - sie war ja die einzige Sängerin der Welt, die zu allen dreien eine herzliche Beziehung pflegte - von ihr irgendwann einmal auch die Isolde auf der Bühne hören wollten. - Wie sie einst nach reiflicher Überlegung zur Telefonzelle ging, um Bernstein nach langem Hin und Her doch abzusagen, hat die Ludwig oft erzählt.
Mut und Übermut in der Oper
Vor solchem Übermut hat die aus einem Sängerhaushalt stammende Künstlerin stets ihre Mutter bewahrt: Dem Rat von Eugenie Besalla-Ludwig folgte die Tochter bedingungslos. Er ließ immerhin dramatische Ausflüge ins Sopranfach bis hin zur Färberin in Strauss' Frau ohne Schatten zu, vor allem aber den Fidelio, die "einzige Partie, wegen der es sich überhaupt zu singen lohnt", sagt die Künstlerin in Momenten, in denen sie die "Lust am eigenen Geschrei" gerade vergisst . . .Nun haben wir noch gar nicht von der begnadeten, weil auch unvergleichlich klar artikulierenden Liedgestalterin gesprochen - aber beim "Nachhören" der gottlob zahlreichen Aufnahmen, die sich in jeder gut sortierten Diskothek finden müssen, stößt man nebst Juwelen wie Otto Klemperers Aufnahme von Mahlers Lied von der Erde wohl auch auf die Winterreise mit James Levine - von einer hymnischen Kritik Joachim Kaisers animiert, hat die Sängerin, die ihre eigenen Aufnahmen nicht sammelt, sich die CD besorgt, abgehört und dann befunden: "Es interessiert mich nicht mehr."
Sie darf das. Sie kann das.
Wir können es nicht. Wir lauschen - und empfinden nach wie vor die unbändige Lust an ihrem Gesang. Und freuen uns überdies, die Künstlerin, wenn schon nicht fasziniert von eigenen Aufnahmen, zumindest nach wie vor interessiert am Fortgang der Gattung Oper zu sehen - und ihr zum unglaublichen Neunziger noch viele Jahre angstfreier Besuche ihrer Opern- und Festspielhäuser zu wünschen!
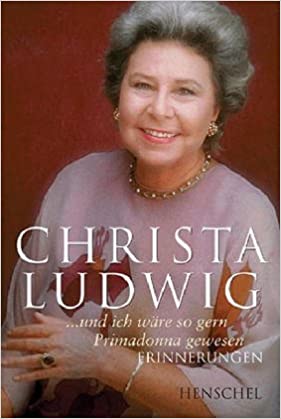
"... und ich wär so gern Primadonna gewesen"
einen durchaus koketten Titel hat Christa Ludwig ihren lesenswerten Memoiren gegeben.