Die Entstehungsgeschichte der Komposition suggeriert, daß dem Komponisten sein Werk selbst über den Kopf gewachsen ist. Geplant war eine Messe zur Begleitung der feierlichen Inthronisation von Beethovens Schüler, seinem hochadeligem Freund und Gönner Erzherzog Rudolph als Erzbischof von Olmütz. Doch als Beethoven den Schlußstrich hinter seine Partitur zog, war dieses Ereignis längst vorbei. Die Messe wurde zu so etwas wie einem Kompendium historischer musikalischer Satztechniken aus der Perspektive eines innovatorischen Genies. Als hätte Beethoven versucht, die Musikgeschichte noch einmal aufzuarbeiten, um den Boden für die musikalische Moderne fruchtbar zu machen - tatsächlich klingen Passagen aus der Messe und mancher Satz aus den späten Quartetten avantgardistischer als vieles, was 100 Jahre später die Welt ästhetisch erschüttern sollte . . .
Über die ohnehin formsprengenden Dimensionen der ersten Messkomposition Beethovens (C-Dur, op. 86), die schon ihren Auftraggeber, den Füsten Esterházy gehörig irritiert hatte, geht die Missa noch weit hinaus. So hat Beethoven eine Aufführung des Gesamtwerks nicht erlebt. In St. Petersburg scheint es 1824 zur eigentlichen »Uraufführung« gekommen zu sein, allerdings vermutlich unter Auslassung des Credo. Gesichert ist die Aufführung der Sätze Kyrie, Credo und Agnus Dei mit deutschem Text unter dem Titel Drei Hymnen in Beethovens letztem öffentlichen Konzert am 7. Mai 1824 am Tag der Uraufführung der Neunten Symphonie in Wien. Eine Aufführung der lateinischen Messe im Konzertsaal wäre im katholischen Wien jener Jahre undenkbar gewesen - und den Gottesdienst hätte ein Werk dieses Ausmaßes gesprengt.
Die Messe beginnt mit dem kürzesten der fünf Abschnitte, dem
Kyrie, das im Vergleich zu anderen Vertonungen des Ordinariums - abgesehen von Bachs
Hoher Messe - schon enorme Dimensionen annimmt. Nach einer Introduktion, die in ihren harten dynamischen Kontrasten oft mit der Hell-Dunkel-Wahrnehmung beim Eintritt in ein Kirchenschiff verglichen wurde, setzt der Chor mit einer massiven Anrufung Gottes ein, die Solostimmen folgen nach der Reihe mit schwebenden Einsätzen, die die feierlich-metaphysische Atmosphäre noch steigern. Der Mittelteil
(Christe eleison) ist bewegter, zuletzt kehrt, Symbol der Trinität, der Eingangsteil variiert wieder.
Das
Gloria beginnt zum Lob Gottes mit einem ekstatischen Freudenhymnus, dem die Bitten der Gemeinde um Erlösung in schmerzhaften Klagelauten eingeschrieben sind. Manche Worte des Textes meißelt Beethoven rücksichtlos direkt in die musikalische Substanz seiner Komposition: das
omnipotens als Symbol der unüberwindlichen Macht Gottes in jäh hereinbrechendem dreifachen Forte, das respektvolle
adomramus te der anbetenden Gläubigen in gehauchtem Pianissimo. Den alten Brauch, diesen Teil der Messe mit einer großen Fuge abzuschließen, übertrumpft Beethoven, indem er gleich zwei Fugen vorsieht, deren letzte in ein
Presto-Delirium mündet, dessen abschließender
Gloria-Ruf noch über den Schlußakkord des Orchesters hinaushallt.
Streng und gemessen nimmt sich dagegen das
Credo aus, das Glaubensbekenntnis, das Beethoven in der Manier der klassischen großen Messen in deutlich voneinander abgesetzte Sinneinheiten gliedert. Innerhalb derer findet der Komponist für einige der innigsten Botschaften des katholischen Glaubens ausdrucksstarke Klangbilder, allen voran für die Inkarnation Gottes und den Leidensweg Christi, dessen Kreuzestod in drastischen, grell dissonierenden Zeichen gemalt wird. Wie sehr sich Beethoven an historischen Vorbilder unterschiedlichster Stilrichtungen orientiert, läßt sich am leichtesten an den aus tiefsten Tiefen hochfahrenden »Auferstehungs«-Metaphern beim
et resurrexit ablesen: Der Komponist bindet auch solch überaus simple Klangsymbole nahtlos in seine hochkomplexe Partitur ein.
Höchst subjektiv entfernt sich Beethoven im
Sanctus von der in aller Regel kraftvollen dreimaligen Beschwörungen der Heiligkeit Gottes in klassischen Meßkompositionen: Sein
Sanctus ist zart, voll Poesie und inniger Hingabe. Erst das
pleni sunt coeli und das
Osanna finden zu jubilierenden Ausbrüchen. Während das
Benedictus wiederum zur mystischen Versenkung in das Glaubensgeheimnis einlädt: Ein Violinsolo ruft Assoziationen zum Urzustand der Welt am Beginn der Schöpfungsgeschichte hervor, als schwebte der Geist Gottes über den Wassern. Die Musik weist auf die transzendente Schönheit der Adagio-Gesänge in den folgenden Streichquartetten Beethovens voraus.
Im
Agnus Dei eleben wir den Skeptiker Beethoven in seinem Ringen um den Glauben. Viel ist gerätselt worden über den Komponisten und sein Verhältnis zur Religion. Antworten auf die Frage kann trotz einiger höchst widersprüchlicher Aussagen, letzlich nur seine Musik geben. Und die ist gerade im Falle dieser »Bitte um inneren und äußeren Frieden« mit einem unmißverständlichen Fragezeichen versehen. Je weiter die Musik in die Bereiche des Mysteriums vordringt, desto greller mischen sich Störgeräusche aus der Realität in den Gottesdienst, Kriegslärm mit Pauken und Trompeten unterstreicht die immer dringlicher werdenden Bitten
Gib uns den Frieden! Deren letzte, vom Chor sicher und fest vorgetragen, mündet zunächst noch in ein vorsichtiges Piano, ehe - forstissimo - das Orchester mit einer bekräftigenden Schlußgeste das Schlußwort spricht.
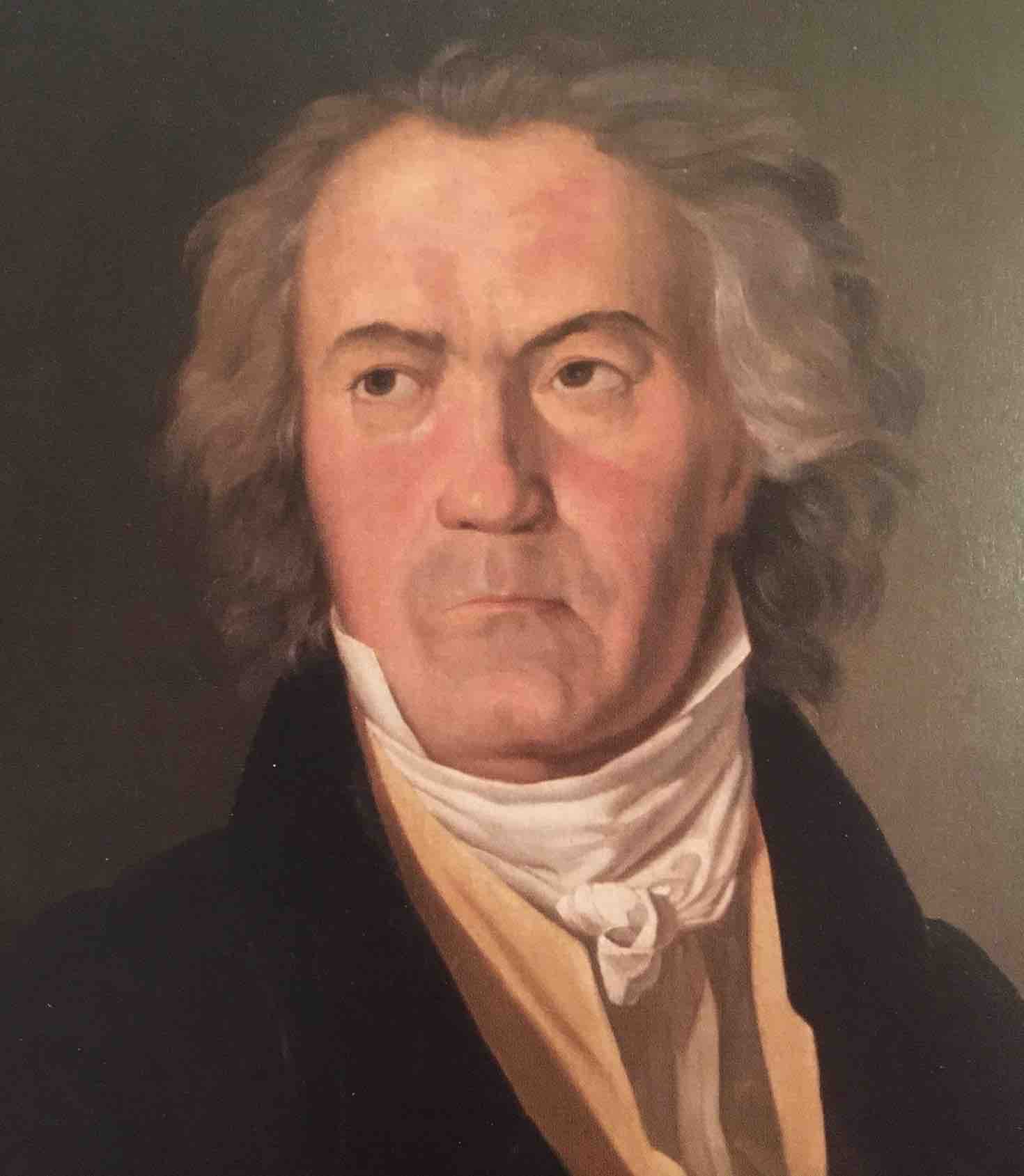 MISSA SOLEMNIS
MISSA SOLEMNIS