Paul Paray
1886 - 1979
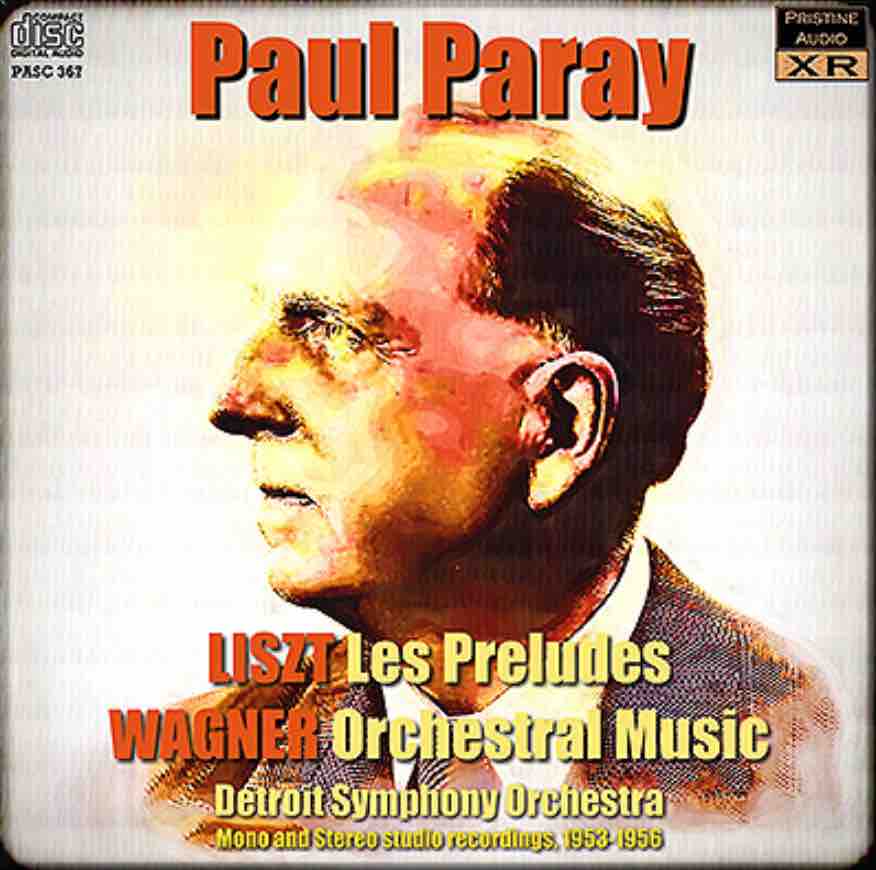 Paray stammte aus Rouen und studierte am Pariser Conservatoire Komposition und Dirigieren. Seine ersten Sporen verdiente er sich als Arrangeur, Pianist und Songschreiber für ein Pariser Kabarett. Nebenher spielte er als Cellist im Orchester des Sarah-Bernhardt-Theaters. 1911 gewann er den begehrten Rom-Preis, dessen Früchte er allerdings nicht ausreichend ernten konnte: Seinen Aufenthalt in der italienischen Metropole beendet der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Als Soldat geriet er in Kriegsgefangenschaft, konnte sich jedoch nach 1918 im Pariser Musikleben etablieren. Als Leiter des Orchestre Lamoureux und später der Concerts Colonne präsentierte er in zahlreichen
Paray stammte aus Rouen und studierte am Pariser Conservatoire Komposition und Dirigieren. Seine ersten Sporen verdiente er sich als Arrangeur, Pianist und Songschreiber für ein Pariser Kabarett. Nebenher spielte er als Cellist im Orchester des Sarah-Bernhardt-Theaters. 1911 gewann er den begehrten Rom-Preis, dessen Früchte er allerdings nicht ausreichend ernten konnte: Seinen Aufenthalt in der italienischen Metropole beendet der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Als Soldat geriet er in Kriegsgefangenschaft, konnte sich jedoch nach 1918 im Pariser Musikleben etablieren. Als Leiter des Orchestre Lamoureux und später der Concerts Colonne präsentierte er in zahlreichen 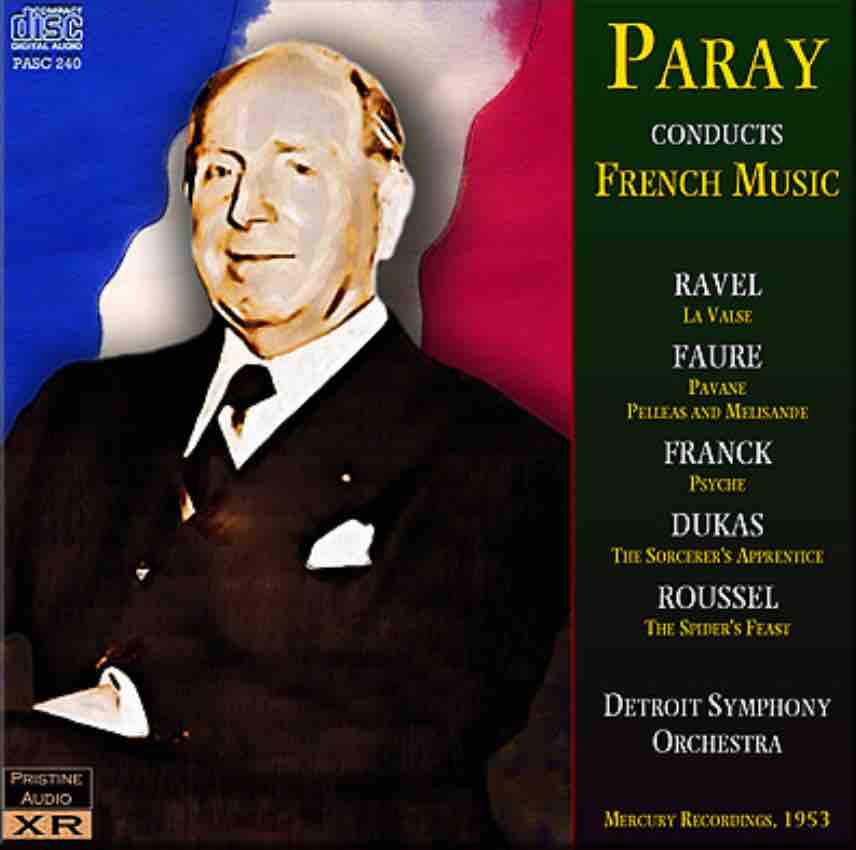 Konzerten Novitäten aus der Werkstatt der führenden französischen Komponisten der Zwischenkriegszeit von Fauré bis Roussel und Ibert. Unter seiner Leitung absolvierten Solisten wie Jascha Heifetz oder Yehudi Menuhin ihre Paris-Debüts.
Konzerten Novitäten aus der Werkstatt der führenden französischen Komponisten der Zwischenkriegszeit von Fauré bis Roussel und Ibert. Unter seiner Leitung absolvierten Solisten wie Jascha Heifetz oder Yehudi Menuhin ihre Paris-Debüts.Eine Pioniertat war die Aufführung des kompletten Rings des Nibelungen im Pariser Palais Garnier.
Resistence
nach dem Einmarsch der Deutschen, 1940, setzte Paray mutige Zeichen des Widerstands und der Insubordination. Als man dem Colonne-Orchester seinen Namen raubte, weil dieser an den jüdischen Gründer der Konzertserie erinnerte, zog sich Paray sofort von der musikalischen Leitung zurück. In Lyon dirigierte er wenige Tage nach einem propagandistisch ausgeschlachteten Gastspiel der Berliner Philharmoniker im Jahr 1942 ein Konzert mit dem lokalen Orchester, das ausschließlich Musik enthielt, die in jener Zeit als »entartet« galt und verboten war. Am Ende des Konzert dirigierte - mit dem Gesicht zum Publikum gewandt - unter lautem Jubel die Maseilleise.In der Folge übernahm er die Leitung des Orchesters von Monte Carlo und versuchte dort so viele Musiker wie möglich zu beschäftigen, die in Frankreich wegen der »Rassegesetze« ihre Engagements verloren hatten.
Die Zeit nach 1945
Nach Ende des Kriegs setzte Paray allerdings Versöhnungsgesten. Die Konfrontation mit den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Wilhelm Furtwängler wurde 1950 unter friedlichen Vorzeichen in Paris wiederholt: Die deutschen Gäste musizierten im Palais Garnier, Paray dirigierte im Palais de Chaillot.Schon 1946 war er erstmals wieder in Wien zu erleben und wurde stürmisch gefeiert. Im Jahr darauf konnte er im Rahmen eines Konzerts des Singvereins und der Wiener Symphoniker im großen Musikvereinssaal seine Messe für Jeanne d'Arc vorstellen, ein effektvolles Chorwerk aus dem Jahr 1931, dem der Text der katholischen Messe zugrunde liegt, doch unter Auslassung des Credos, um das Werk für überkonfessionelle Zelebrationen tauglich zu machen. Solisten wie Irmgard Seefried und Julius Patzak wirkten an der Wiener Aufführung mit. Unmittelbar darauf teilte sich Paray eine Tournee der Wiener Philharmoniker durch die Schweiz und Frankreich mit Josef Krips, dirigierte aber den Löwenanteil dieser Tournee selbst, vor allem die Konzerte in Zürich, Genf, Straßburg, Lyon, Nizza und Paris.
Zu weiteren Begegnungen mit den Wiener Philharmonikern kam es danach allerdings nicht mehr . . .
Detroit
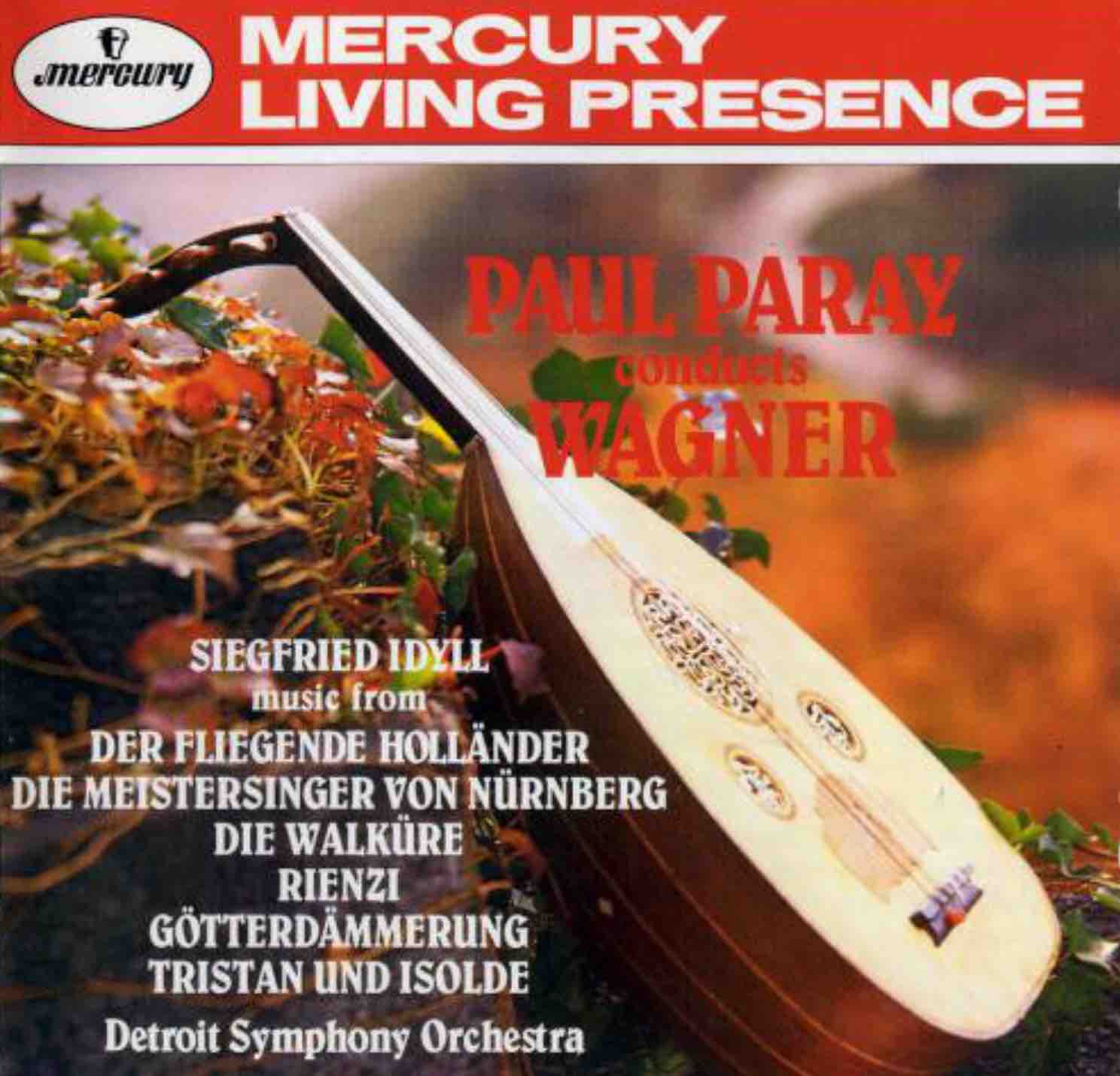 Anfang der Fünfzigerjahre ging Paray in die USA, wo er für ein Jahrzehnt die Leitung des Detroit Symphony Orchestra übernahm, mit dem er für das Label Mercury bemerkenswerte Schallplattenaufnahmen machte. Paray war ein Mann der großen dramatischen Orchester-Geste und konnte Steigerungen wirkungsvoll aufbauen und bruchlos zu Ende führen. Der Beginn von Wagners Ouvertüre zum Fliegenden Holländer sagt mehr über den Impetus seiner Interpretationen als tausend Worte.
Anfang der Fünfzigerjahre ging Paray in die USA, wo er für ein Jahrzehnt die Leitung des Detroit Symphony Orchestra übernahm, mit dem er für das Label Mercury bemerkenswerte Schallplattenaufnahmen machte. Paray war ein Mann der großen dramatischen Orchester-Geste und konnte Steigerungen wirkungsvoll aufbauen und bruchlos zu Ende führen. Der Beginn von Wagners Ouvertüre zum Fliegenden Holländer sagt mehr über den Impetus seiner Interpretationen als tausend Worte.
Klanglich sind Parays Aufnahmen stets perfekt austariert und das Stimmengewebe bleibt auch in komplexen Strukturen glasklar durchhörbar. Seine - meist rigoros durchgehaltenen, als von einem »modernen« Zugang kündenden - Tempi sind oft überraschend zügig - eine der raschesten - für viele verstörenden - Einspielungen von Beethovens Pastorale entstand 1954 in Detroit unter seiner Leitung.
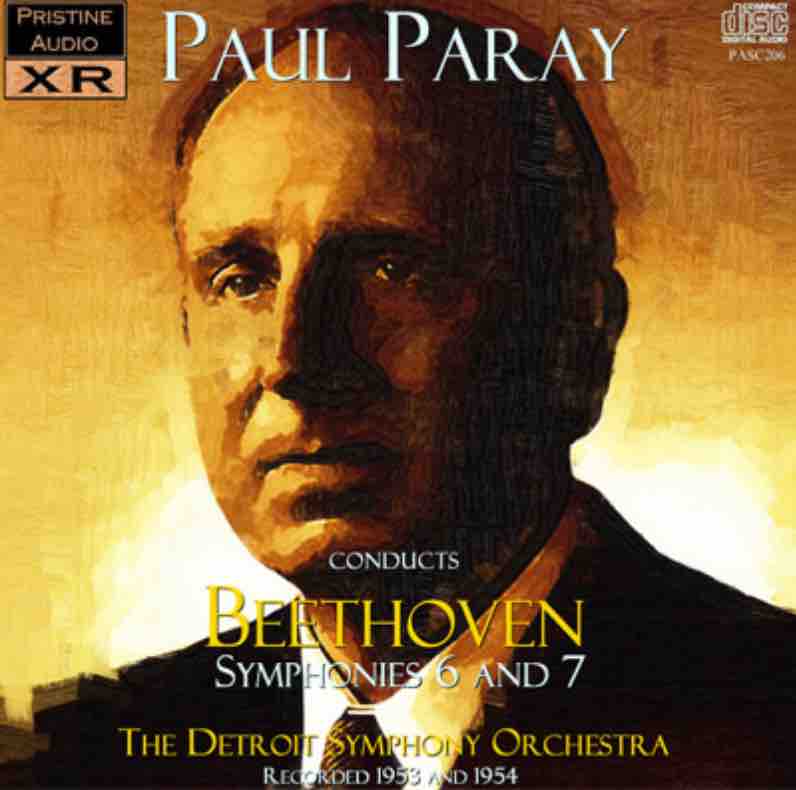 Sie läßt auch die scharf geschliffenen Akzente hören, die Paray setzte und damit Energien freischlagen konnte, die etwa in Beethovens Siebenter von brisanter Wirkung sind, ohne daß der Dirigent hier ein überzogenes Tempo anschlägt.
Sie läßt auch die scharf geschliffenen Akzente hören, die Paray setzte und damit Energien freischlagen konnte, die etwa in Beethovens Siebenter von brisanter Wirkung sind, ohne daß der Dirigent hier ein überzogenes Tempo anschlägt.