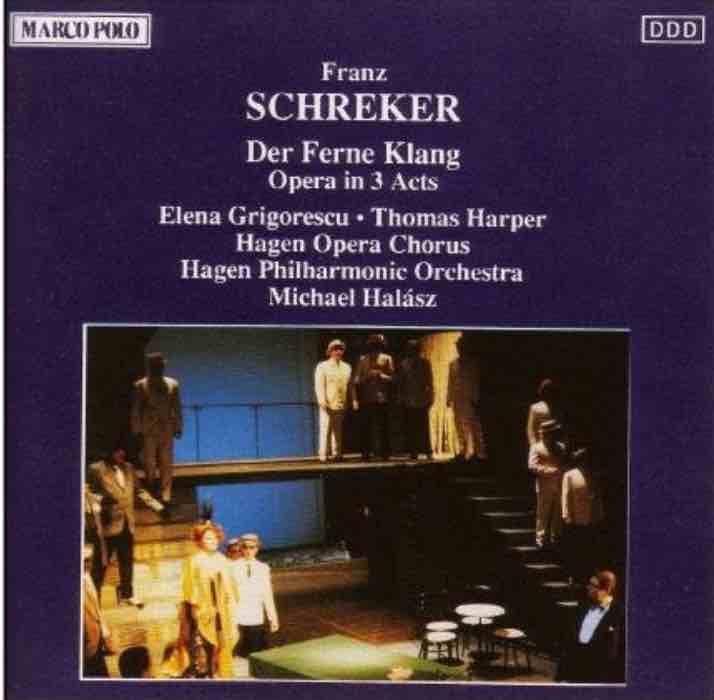Fritzerl und Greterl
verliefen sich im Wald
»Der ferne Klang« in Graz
»Der ferne Klang« als erste Premiere der neuen Intendantin an der Grazer Oper. Warum eigentlich? Genauer betrachtet ist dieses Stück hohles Geklingel, textlich wie musikalisch.
September 2015
Einen rauschenden Erfolg fuhr die neue Intendantin der Grazer Oper mit ihrer ersten Premiere ein: Franz Schrekers Oper "Der ferne Klang" machte dem Publikum offenbar mächtigen Eindruck. Die Rechnung scheint aufgegangen: Ein Werk wieder zur Diskussion zu stellen, das während der NS-Herrschaft zur "entarteten Kunst" gerechnet wurde, ist meist ein dankbares Unterfangen. Freilich, gerade mit dem "Fernen Klang" wurden in den vergangenen Jahren aus diesem Grund wiederholt Reanimationsversuche angestellt, alle verliefen im Sand. Während der so erfolgreichen Grazer Premiere konnten Musikfreunde, für die diese Aufführung daher keine Erstbegegnung war, in Ruhe Überlegungen anstellen, warum das so ist.Der erste Eindruck beschert dem Stück ganz offenkundig Sympathien. Genauer betrachtet, bleibt vom glitzernden Spiel mit erwachenden sexuellen Regungen und verklemmten Trau-mi-net- und Mag-di-net-Attitüden allerdings vor allem eins in Erinnerung: hohles Geklingel, textlich wie musikalisch.
Ein Komponist auf der Suche
Franz Schreker war ja sein eigener Librettist, was ihm wiederholt den Ehrentitel des einzigen befugten Wagner-Nachfolgers einbrachte. Tatsächlich scheut er vor unverhohlenen Wagnerismen auch nicht zurück. "Ring" und "Parsifal" färben immer wieder ab. Und die Musik, die Schreker zu den oft unsäglich banalen Versen schreibt, ist im "Fernen Klang" beinah ausschließlich wegen der raffinierten Orchesterbehandlung von Reiz: Mit Klangfarben spielt Schreker wie einer der wirklich Großen seiner Zeit. Allerdings mangelt es ihm auch diesbezüglich an Originalität.Ungeschickterweise ist der Held seiner Oper ja Komponist und auf der Suche nach einem rätselhaft schönen Klang. Da wäre die Fantasie des Komponisten, der einen Komponisten komponiert, aufs Äußerste gefordert. Doch symbolisiert Schreker den ominösen fernen Klang mit simpelsten Mitteln: Wenn dieser Fritz von seinen Visionen schwärmt, hört das Publikum Harfen, Glocken und Celesta-Geklingel. Die Banalität der Sprache setzt sich bei den klanglichen Mitteln fort.
Das insgesamt ungeformte Raunen und Schwelgen in spätromantischer Harmonik bedürfte im Übrigen wenigstens ein, zwei Mal pro Akt einer melodischen Katharsis. So haben es von Richard Strauss bis Erich Wolfgang Korngold alle effektsicheren Meister der Zeit gehalten. Und es ist ihnen in der Regel auch immer einiges Ohrwurmträchtiges eingefallen.
Im "Fernen Klang" ist es hingegen kein "Sehnen und Wähnen", ja nicht einmal ein Stück Glück, das uns im Gedächtnis verblieb, sondern mit Nachsicht aller Taxen eine zweitaktige Phrase, über die sich Fritz und seine Gretel in einem kurzen Duett verbreitern.
Der Rest ist Rezitativ, angereichert mit allerlei Klanggebärden, die sich mehrheitlich als parsifalesker Wagner-Nachhall entpuppen, den das Grazer Orchester unter Dirk Kaftan immerhin mit Lust auskostet. Das klingt imposant und übertönt in vielen Fällen, was an Gesang von der Bühne kommt. Manchmal übertüncht es gnädig technische Mängel, vor allem bei Daniel Kirchs Fritz, der nur in der Mittellage wirklich sicher und heldisch tönt. Johanni van Oostrum gibt die Grete, auch sie im mittleren Bereich ihres Soprans von fülliger Ausdruckskraft. Die Regie versucht mit einigem Geschick, der krausen Geschichte Form zu geben, und macht aus dem bei Schreker nur im ersten Akt hereinlugenden "alten Weib" eine Hauptrolle: Dshhamilja Kaiser wird zum Alter Ego der Grete, singt mit entsprechend jugendlicher, frischer Stimme, übernimmt im zweiten Akt dann auch diverse Sprechrollen und kündigt während der sonoren, doch vergeblichen Werbung des Grafen (Markus Butter) die Wiederkehr des verloren geglaubten Fritz an.