Zdeněk Fibich
(1850-1900)
Unter den böhmischen Romantikern ist Fibich, wiewohl halb vergessen neben Smetana und Dvorak der dritte bemerkenswerte Meister.
 Seinen ersten Symphoniesatz komponierte der talentierte Sohn eines böhmischen Oberförsters bereits mit 14 - und dirigierte auch die Uraufführung selbst. Die Mutter hatte das Talent des Burschen längst erkannt und ihn auf eine Musikschule geschickt. Bald durfte der junge Zdeněk nach Leipzig, wo sein Onkel, Raimund Dreyschock am Konservatorium Violine unterrichtete. Fibich durfte an diesem Institut bei den führenden Lehrerpersönlichkeiten studieren: Die Ausbildung bei Moscheles, Richter und Jadassohn konnte er mit 17 bereits abschließen. Nach weiteren Studien und Kapellmeister-Tätigkeiten in Prag und Wilna kam er als Dirigent ans Prager Nationaltheater.
Seinen ersten Symphoniesatz komponierte der talentierte Sohn eines böhmischen Oberförsters bereits mit 14 - und dirigierte auch die Uraufführung selbst. Die Mutter hatte das Talent des Burschen längst erkannt und ihn auf eine Musikschule geschickt. Bald durfte der junge Zdeněk nach Leipzig, wo sein Onkel, Raimund Dreyschock am Konservatorium Violine unterrichtete. Fibich durfte an diesem Institut bei den führenden Lehrerpersönlichkeiten studieren: Die Ausbildung bei Moscheles, Richter und Jadassohn konnte er mit 17 bereits abschließen. Nach weiteren Studien und Kapellmeister-Tätigkeiten in Prag und Wilna kam er als Dirigent ans Prager Nationaltheater. Seiner Liebe zum Musiktheater frönte er auch, nachdem er sich mit 30 ganz dem Komponieren widmete. Opern und große Symphonik dominieren den Werkkatalog.
Die Musik knüpft hörbar an die deutsche Romantik an, Mendelssohn und Schumann standen Pate. Das böhmische Idiom wird zwar immer wieder hörbar, wirkt aber - anders als bei Smetana oder Dvorak - dezent in die romantisch-schwelgerische Tonsprache eingebunden.
Die Opern zeigen deutlich auch den Einfluß Richard Wagners; namentlich Hedy verarbeitet offenkundig das Tristan-Erlebnis und ist von Schopenhauers Philosophie beeinflußt. (Fibich sprach Deutsch so fließend wie Tschechisch.)
Musiktheater
Symphonik
Tondichtungen
Klavierwerke, Programm-Musik
Eine ganze Reihe von Klavier-Stücken hat Fibich über die Jahre hin in Serien herausgebracht. Sie kultivieren den romantischen Tonfall seiner Musik in der kleinen Form, die vielen Studien oder Musikalischen Gemälde stehen stilistisch in einer Reihe mit den Charakterstücken Schumanns, hie und da sanft angereichert durch slawische Koloristik. Unter der Opuszahl 41 hat Fibich mehrere Bücher mit Images, impressions et souvenirs zusammengefaßt. Damit steht Fibich durchaus in einer Tradition, die in seiner Heimat gepflegt wurde. Die unmittelbaren Vorgängerwerke sind die lyrischen Stücke Johann Wenzel Tomascheks.Mit seinen Melodramen und Tondichtungen gab Fibich sogar für Dvořák ein Vorbild ab: Noch bevor sich dieser der tschechischen Mythologie und den Märchen-Balladen Karel Jaromir Erbens zuwandte, vertonte Fibich etwa den später auch von Dvořák zur Vorlage genommenen Wassermann (1883, Dvoraks gleichnamige Tondichtung entstand Mitte der Neunzigerjahre).
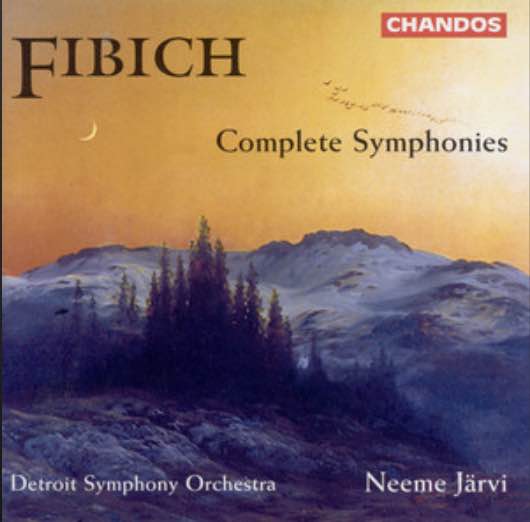 Die drei Symphonien hat Neeme Järvi mit seinem Orchester in Detroit aufgenommen (Chandos)
Die drei Symphonien hat Neeme Järvi mit seinem Orchester in Detroit aufgenommen (Chandos)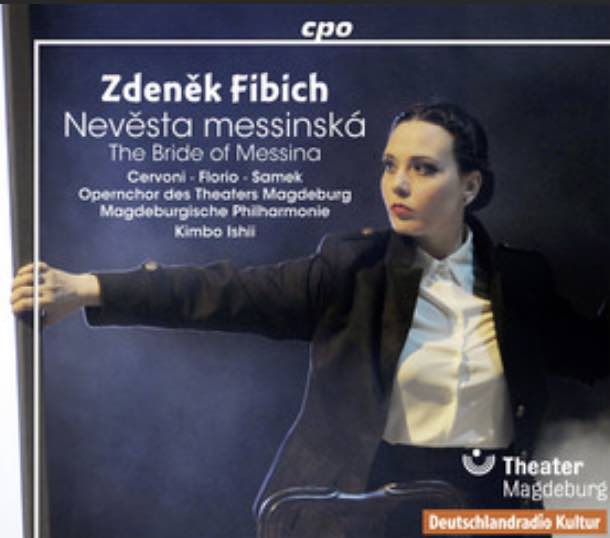 Die Schiller-Oper Die Braut von Messina ist in einem Livemitschnitt aus Magdeburg greifbar, eine zum Teil vokal prachtvolle Dokumentation, die dank des engagierten Zugriffs der Magdeburgischen Philharmonie mehr als eine Ahnung von Fibichs dramatischem Talent vermittelt. (cpo)
Die Schiller-Oper Die Braut von Messina ist in einem Livemitschnitt aus Magdeburg greifbar, eine zum Teil vokal prachtvolle Dokumentation, die dank des engagierten Zugriffs der Magdeburgischen Philharmonie mehr als eine Ahnung von Fibichs dramatischem Talent vermittelt. (cpo)Er arbeitet durchaus mit Leit- oder »Erinnerungsmotiven«, die prägnant genug sind, sich ins Gedächtnis einzuprägen.
Die Handlung
Die Handlung erzählt von der Fürstin Isabella von Messina, die ihre verfeindeten Söhne Manuel und Cesar versöhnen möchte, die ihre Anhänger jeweils hinter sich versammelt haben. Ein Bürgerkrieg droht.Doch das Schicksal will, daß beide Brüder sich nach eingen Versöhnungsgesten in dieselbe schöne Unbekannte verlieben - und nicht erkennen, daß es sich bei dieser jungen Dame um ihre verschollene Schwester Beatrice handelt.
Die Mutter hatte das Mädchen einst in ein Kloster gesteckt, um zu verhindern, daß sich die Prophezeiung erfüllen könnte, das Kind würde die Schuld am Ende des Fürstengeschlechts tragen.
Das Schicksal schlägt zu: Aus der Eifersucht der Brüder speist sich erneut der Haß. Manuel und Cesar kommen ums Leben. Die beiden Frauen bleiben klagend allein zurück.
Die Musik
Fibichs Partitur ist von großem Raffinement, harmonisch ganz im Banne der Spätromantik - und handwerklich bewundernswert gearbeitet: Als gelehriger Schüler der deutschen Romantik bewährt er sich schon in den ersten Takten des Orchestervorspiels: Das mächtige Unisono der Blechbläser, das am Ende der Oper wiederkehren wird, kontrastiert ein zartes Violinsolo, das freilich ganz nach Franz Liszts Vorbild aus dem selben motivischen Keim entwickelt ist. Entsprechend fantasievoll und psychologisch einfühlsam harmonisiert mit der Handlung verarbeitet Fibich in der Folge seine Erinnerungs-Motive.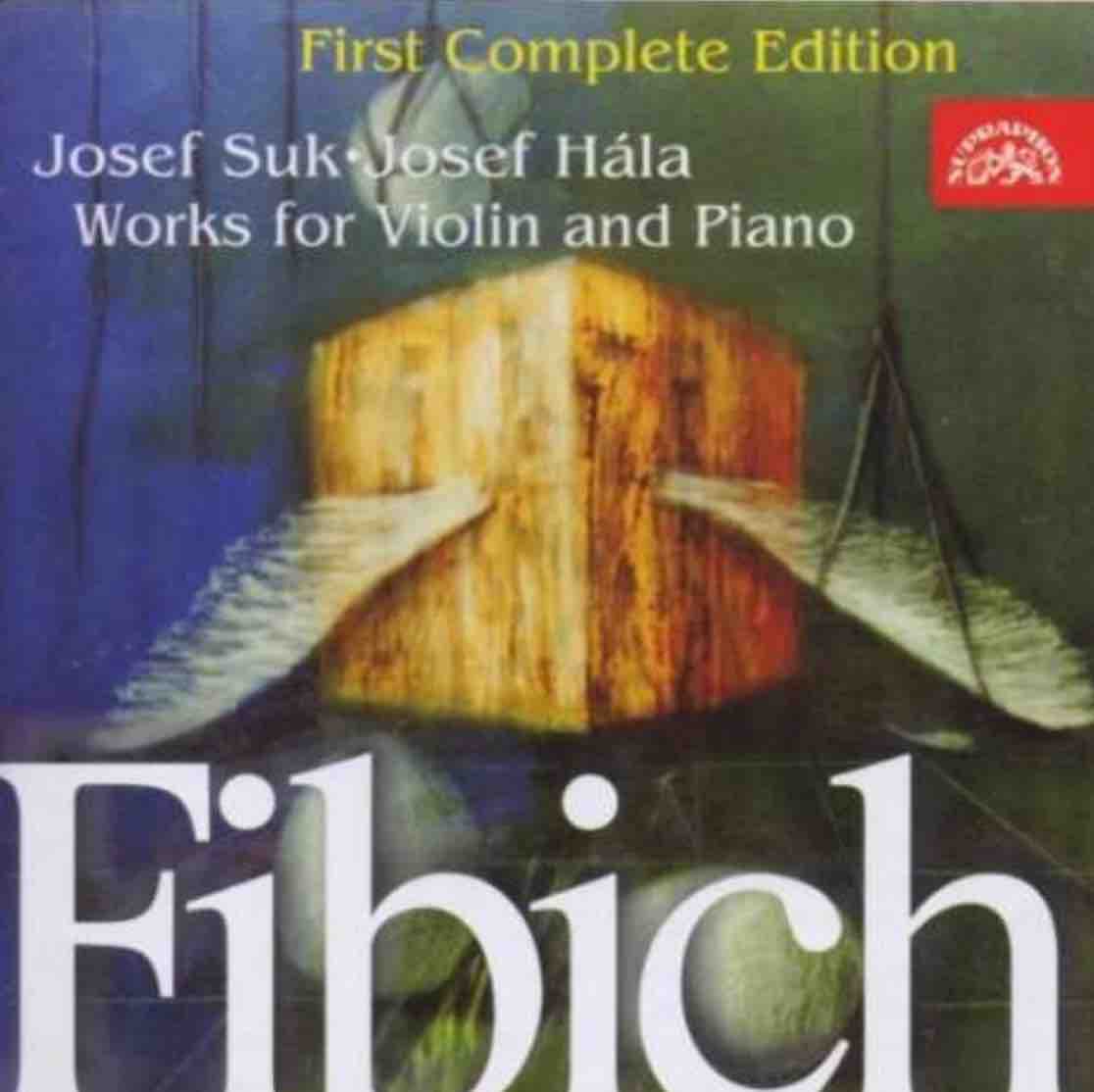 Die Entwicklung des jugendlichen Talents läßt sich an den von Josef Suk und Josef Hála hinreißend musizierten Aufnahmen der Werke für Violine und Klavier studieren: Von der Sonatine des 19-jährigen bis zur formal beherrschten, wunderbar lyrischen Violinsonate (1876). (Supraphon)
Die Entwicklung des jugendlichen Talents läßt sich an den von Josef Suk und Josef Hála hinreißend musizierten Aufnahmen der Werke für Violine und Klavier studieren: Von der Sonatine des 19-jährigen bis zur formal beherrschten, wunderbar lyrischen Violinsonate (1876). (Supraphon)