Romeo und Julia
Ein seltsames Hybrid-Produkt aus Oper, Oratorium und Symphonie - ideal für visionäre Konzert-Ereignisse, die freilich selten stattfinden
Bei diesem Werk schlägt der unerschrockene Uraufführungsdirigent von Strawinskys »Sacre du Printemps«, Pierre Monteux, nach wie vor alle Dirigenten, die sich an der schwierigen Partitur versuchen.
Als die Aufnahme (auf Westminster) Anfang der Sechzigerjahre erstmals in den Handel kam, staunten die Rezensenten, daß dieser Dirigent sogar den nicht gerade unbedeutenden Kollegen Charles Munch, der zwei Jahre zuvor die erste nennenswerte Aufnahme von »Romeo et Juliette« dirigiert hatte, aus dem Feld schlagen konnte: Bei Monteux stimmt - ein paar allzu stark vibrierende Töne von Regina Resniks Julia einmal abgesehen - einfach alles.
Das London Symphony Orchestra spielt mit einer Spiellaune und Farbenpracht, vor allem aber: mit einer rhythmischen Energie, die tatsächlich noch den letzten Tropfen koloristischer Erfindung aus der Partitur preßt.
Die geheimnisvollen Erzählungen der Königin Mab, der »Fee der Träume« sind von einer Luzidität und Leichtigkeit, die kein späterer orchestraler Versuch in raffiniertester Digitaltechnik schlagen konnte.
Die kämpferischen Aktionen zwischen den Montagues und den Capulets führen zu einem orchestralen Pandämonium der Sonderklasse und die Liebesszene ist von transzendenter, vollkommen selbstvergessener Schönheit. Wer je - wie der Autor dieses Texts! - Berlioz der Oberflächlichkeit zeiht, muß hier zumindest für 20 Minuten seiner Ketzerei abschwören...
Von den späteren Versuchen, das Werk gesamt in all seiner Buntheit und Unausgewogenheit auf Tonträger zu bannen, kommt der Aufnahme Lorin Maazels mit den Wiener Philharmonikern höchster Rang zu. Zwar passen die Stimmen der Superstars Christal Ludwig und Nikolai Ghiaurov nicht wirklich ideal zu den ihnen hier zugewiesenen Rollen; aber das Spiel des Orchesters ist von beeindruckernder Ausdrucksstärke. 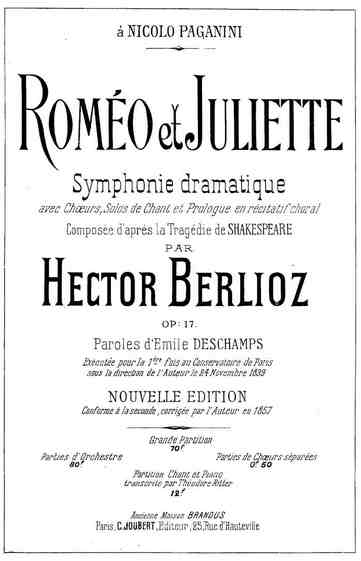 Und vor allem: Maazel »serviert« das Stück als Symphonie - mit eingestreuten dramatischen Szenen. Das ist vermutlich der Zugang, den Berlioz vor einer Darstellung der Partitur als verkappten Opernvesuch präferiert hätte. Illustrative Details sind zwar liebevoll gestaltet, aber über allem herrscht doch ein gebieterischer Wille zur übergreifenden formalen Disposition.
Und vor allem: Maazel »serviert« das Stück als Symphonie - mit eingestreuten dramatischen Szenen. Das ist vermutlich der Zugang, den Berlioz vor einer Darstellung der Partitur als verkappten Opernvesuch präferiert hätte. Illustrative Details sind zwar liebevoll gestaltet, aber über allem herrscht doch ein gebieterischer Wille zur übergreifenden formalen Disposition.
Der mußte Maazel nicht mühen, als er das erste Mal für dieses Werk ins Plattenstudio ging. Als junger, aufstrebender Maestro durfte er mit Karajans Berliner Philharmoniker für DG Berlioz aufnehmen - und zwar nur die instrumentalen Partien des Werks; und da gab Maazel eine Visitenkarte ab, wie sie bunter und eindrucksvoller wahrscheinlich noch kein Dirigent abgeben konnte: Das Fest bei Capulets muß gehört haben, wer wissen will, wie sich ein Orchester nach Toscaninis Ära noch einmal domptieren ließ - es war, genau genommen, das letzte Mal, daß dermaßen diszipliniert-virtuose Klänge auf Band gebannt wurden. Selbst die Tatsache, daß damals nur ein Mono- und noch kein Stereoband mitlief, kann dem beeindruckenden Hörerlebnis Abbruch tun.


