Die Symphonien
Sergej Rachmaninow
Symphonie Nr. 1 d-Moll op. 13
- Grave – Allegro ma non troppo
- Allegro animato
- Larghetto
- Allegro con fuoco
Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27
- I. Largo. Allegro moderato
- II. Allegro molto
- III. Adagio
- IV. Allegro vivace
Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 44
(1935)
- Lento – Allegro moderato – Allegro
- Adagio ma non troppo – Allegro vivace
- Allegro – Allegro vivace – Allegro (Tempo primo) – Allegretto – Allegro vivace.
Verhältnismäßig viel gespielt wird nur die Zweite Symphonie, doch wird der Musik gern der Vorwurf gemacht, sie klinge nach einem Film-Soundtrack. Das ist ungerecht und absurd, entstand sie doch lange vor der Erfindung des Tonfilms.
Zum Kennenlernen: Ein SINKOPHON über die kaum bekannten Symphonien Nr. 1 und Nr. 3 und ein Tipp für die beste CD-Gesamtaufnahme:
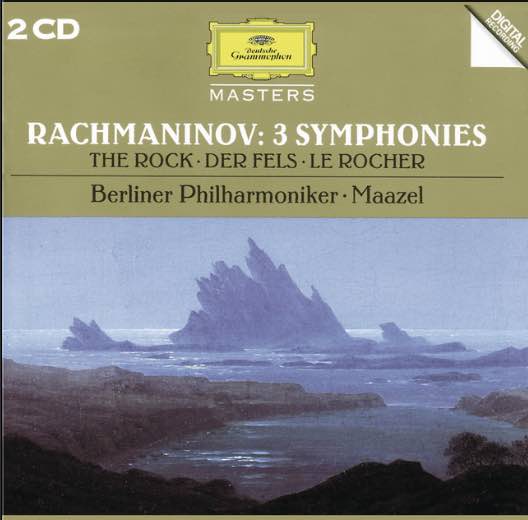 Die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Lorin Maazel - frei von jeglicher Rührseligkeit, klar strukturiert, aber mit aller Klangsinnlichkeit, die russische Spätromantik braucht.
Die Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter Lorin Maazel - frei von jeglicher Rührseligkeit, klar strukturiert, aber mit aller Klangsinnlichkeit, die russische Spätromantik braucht.DA CAPO